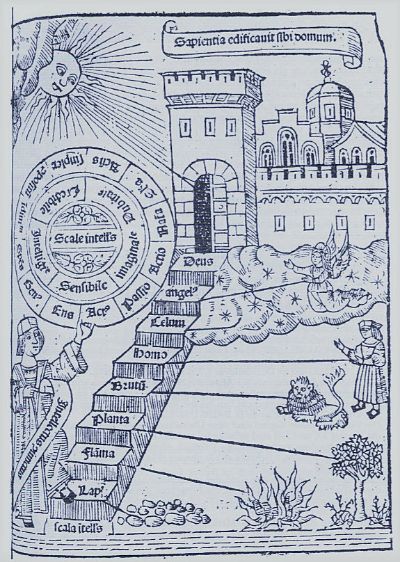 'Chain of Being' 'Chain of Being'
Charakterisierung der
Seelenteile bei Aristoteles
1. Vegetative Seele
Aristoteles
führt in De anima aus, daß bei der
Bestimmung der (drei) Seelenteile weitere Unterteilungen vorgenommen werden
müssen. Er unterscheidet zwei Leistungen der vegetativen Seele (= ernährende
Seele):
Ernährung
und Wachstum einerseits sowie Zeugung und Fortpflanzung andererseits. Es heißt:
"Also ist zuerst über
Ernährung und Fortpflanzung zu sprechen. Denn die ernährende Seele findet sich
auch bei den anderen und sie ist die erste und allgemeinste Fähigkeit der Seele
und Grundlage des Lebens für alle.
Ihre Leistungen sind Fortpflanzung und die Nahrung gebrauchen. Denn dies ist
die naturgemäßeste Leistung für die
Lebewesen ...: nämlich ein anderes hervorzubringen wie sie selbst, das Tier ein
Tier, die Pflanze eine Pflanze, damit sie, soweit sie es vermögen, am Ewigen
und am Göttlichen teilhaben". (De an. II 4, 415 a-415 b)
Weiter:
"Es (das Lebewesen) dauert
nicht als es selbst, sondern wie es selbst, nicht der Zahl, wohl aber der Art
nach eines". (De an. II 4, 415 b)
Nicht
das einzelne (und vergängliche) Lebewesen wird erhalten, sondern die Art, die
für Aristoteles etwas Beständiges ist.
2. Sensitive Seele
Was
Tiere und Pflanzen unterscheidet, ist das Wahrnehmungsvermögen der sensitiven
Seele bei den Tieren. Aristoteles macht deutlich, daß das Fehlen der
Wahrnehmung bei den Pflanzen nicht primär durch das Fehlen von Sinnesorganen
(Organe für das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken oder Tasten) bedingt ist,
sondern durch das Fehlen eines Mittleren.
Er
schreibt:
"Ebenso wird klar,
weshalb die Pflanzen nicht wahrnehmen, obschon sie eine Teilseele besitzen ...
Ursache ist, daß sie kein Mittleres haben und kein Prinzip, das fähig ist, die
Formen der Wahrnehmungsgegenstände aufzunehmen". (De an. II 12, 424
a-424 b)
Das
Mittlere ist für Aristoteles nicht
bloß ein körperliches Zentrum, sondern ein seelisches. Dieses Zentrum, das die
Formen der Wahrnehmungsgegenstände aufzunehmen vermag, würden wir heute als Zentralnervensystem bezeichnen. Von
einem der menschlichen Erfahrung zugänglichen Phänomen, daß Tiere im Gegensatz
zu Pflanzen die Fähigkeit haben, "die Formen der Wahrnehmungsgegenstände
aufzunehmen", schließt Aristoteles auf ein bei Tieren vorhandenes und als sensitive Seele bezeichnetes
unsichtbares Prinzip.
3. Geistseele
Was
den Menschen vor allen anderen Lebewesen auszeichnet, ist nach Aristoteles die
Geistseele. Der Geist, von dem diese Seele ihren Namen hat, wird von
ihm in zwei Kategorien unterteilt.
"Es gibt also Geist
von solcher Art, daß er alles wird, und wiederum einen von solcher, daß er
alles bewirkt als ein besonderes Verhalten, wie etwa das Licht. Denn auf eine
gewisse Weise macht auch das Licht die der Möglichkeit nach vorhandenen Farben
zu wirklichen Farben. Dies ist der abgetrennte Geist, der leidenslos ist und
unvermischt und seinem Wesen nach Wirklichkeit" ... "Aber erst, wenn er (der
Geist) abgetrennt ist, ist er das, was er wirklich ist, und nur dieses ist
unsterblich und ewig. Wir erinnern uns aber nicht daran; denn der eine Teil ist
wohl leidenslos, der leidensfähige Geist aber ist vergänglich, und ohne
diesen gibt es kein Denken". (De an. III 5, 430 a)
An
anderer Stelle liest man,
"daß der
(leidensfähige) Geist der Möglichkeit nach die denkbaren Dinge sei, aber der Wirklichkeit
nach keines, bevor er denkt. Dies muß so sein wie auf einer Schreibtafel, auf
der faktisch noch nichts geschrieben ist. Dasselbe gilt für den Geist". (De an. III 4, 429 b)
Aristoteles
ist so zu verstehen, daß der leidensfähige Geist mit der Geistseele
gleichzusetzen ist. Wie die anderen Seelenteile auch, ist die Geistseele an den
Körper gebunden und damit
vergänglich. Bevor der (neugeborene) Mensch mit dem Denken beginnt, ist die Geistseele leer - wie eine unbeschriebene
Schreibtafel (tabula rasa). Die
Geistseele wird deshalb denkend und vernünftig, weil in sie "von außen" der
(abgetrennte) Geist "einbricht". (De generatione animalium, II 33 - 36, 736a,b)
Die
Geistseele und der abgetrennte Geist sind für Aristoteles das, was den Menschen
vom Tier unterscheidet.
"Nun ist der Mensch
unter allen tierischen Wesen allein im Besitz der Sprache, während die Stimme,
das Organ für Äußerungen von Lust und Unlust, auch den Tieren eigen ist". (De re publica I 1, 2, 1252a - 1253a)
Zitate aus
Aristoteles, De anima, üs. und hrsg. v. O. Gigon, Aristoteles: Vom Himmel. Von der Seele. Von der Dichtkunst, Zürich
1950.
Gekürzt nach Stefan Bleecken, in: Tabvla
rasa, JENENSER ZEITSCHRIFT FÜR
KRITISCHES DENKEN 28 (2007).
Neuer Absatz
David Hume
Untersuchung
in Betreff des menschlichen Verstandes
(An Enquiry Concerning Human
Understanding)
(1748)
Abteilung
IX.
Über
die Vernunft der Tiere.
Alles Schliessen in Bezug auf Tatsachen
stützt sich auf eine Ähnlichkeit, die uns bestimmt, von einer Ursache denselben
Erfolg zu erwarten, den man aus ähnlichen Ursachen hat hervorgehen sehen. Ist
die Ähnlichkeit vollständig, so ist die Analogie vollkommen, und die darauf
gestützte Folgerung gilt als sicher und beweisend.
Niemand
zweifelt bei dem Anblick eines Stück Eisens, dass es schwer und fest sein
werde, gerade wie andere Stücke, die ihm früher vorgekommen sind. Haben die
Gegenstände aber keine volle Gleichheit, so ist die Analogie weniger
vollkommen, und der Schluss weniger überzeugend, obgleich er einige Kraft nach
Verhältniss der Ähnlichkeit und Übereinstimmung behält. Die anatomischen
Beobachtungen, die man bei einem Tiere macht, werden durch diese Art der
Begründung auf alle ausgedehnt, und wenn z.B. der Blutumlauf bei einem
Geschöpf voll erwiesen ist, wie bei dem Frosch oder Fisch, so ergibt dies eine
starke Vermutung, dass dieser Blutumlauf überall Statt habe. Diese Schlüsse der
Analogie kann man weiter, selbst bis zu der hier behandelten
Wissenschaft ausdehnen und jede Lehre, welche die Vorgänge innerhalb des
Denkens oder den Ursprung und die Verbindung der Gefühle beim Menschen erklärt,
wird in ihrer Gültigkeit steigen, wenn sich ergibt, dass nur diese Lehre
dieselben Erscheinungen auch bei andern lebenden Geschöpfen erklärt. Wir wollen
eine solche Probe mit der Hypothese machen, durch welche im Vorgehenden die
Erklärung aller Erfahrungsschlüsse versucht worden ist. Hoffentlich dient
dieser neue Gesichtspunkt zur Bestätigung der frühern Ausführung.
Erstens scheint es
ausgemacht, dass die Tiere so gut wie die Menschen von der Erfahrung lernen und
von ihr annehmen, dass dieselben Wirkungen immer denselben Ursachen folgen.
Durch diese Regel werden sie mit den nächsten Eigenschaften der äussern
Gegenstände bekannt und sammeln allmählich von ihrer Geburt an einen Schatz von
Kenntnissen über die Natur des Feuers, des Wassers, der Erde, der Steine, der
Höhen, der Tiefen u.s.w., so wie über die Wirkungen, welche daraus hervorgehen.
Die Unwissenheit und Unerfahrenheit der Jungen kann man leicht gegen die
Vorsicht und Klugheit der Alten unterscheiden, die durch lange Beobachtung
gelernt haben, das Schädliche zu vermeiden und das Angenehme und Nützliche zu
suchen. Ein an das Freie gewöhntes Pferd wird mit der bestimmten Höhe bekannt,
die es überspringen kann und wird nichts versuchen, was seine Kraft und
Fähigkeit übersteigt. Ein alter Windhund wird den anstrengendsten Teil der Jagd
dem jungem überlassen und sich selbst so stellen, dass er auf den Hasen bei
dessen Schwenkung trifft; seine Voraussetzungen bei solchen Gelegenheiten
stützen sich lediglich auf seine Beobachtung und Erfahrung.
Dies
erhellt noch deutlicher aus den Wirkungen der Zucht und Erziehung der Tiere, welche
durch die passende Anwendung von Belehrungen und Strafen zuletzt eine Reihe von
Handlungen lernen, welche ihrem natürlichen Instinkt und Neigung geradezu
zuwider sind. Ist es nicht die Erfahrung, weshalb ein Hund Schmerz fürchtet, wenn man
ihm droht oder die Peitsche zum Schlag erhebt? Ist es nicht die Erfahrung,
welche ihn auf seinen Namensruf antworten und schliessen lässt, dass man mit
einem solchen willkürlichen Laut eher ihn als seinen Kameraden meine, und das
man ihn rufen wolle, wenn man diesen Laut in einer gewissen Weise und mit einem
bestimmten Tone und Accent ausspricht?
In
all diesen Fällen folgert das Tier offenbar eine Tatsache über das hinaus, was
seine Sinne trifft, und diese Folgerung stützt sich nur auf frühere Erfahrung,
indem das Tier von demselben Gegenstand dieselben Folgen erwartet, die es bei
seinen Beobachtungen aus ähnlichen Gegenständen früher hat hervorgehen sehen.
Zweitens: Unmöglich kann diese Folgerung des
Tieres sich auf einen Beweisgrund und einen Vorgang Innerhalb der Vernunft
gründen, wodurch es schlösse, dass gleiche Folgen sich mit gleichen
Gegenständen verbinden, und dass die Natur in ihren Vorgängen immer regelmässig
sei. Denn wenn wirklich Beweisgründe dieser Art bestehen sollten, so liegen sie
doch für die Beobachtung und für einen so schwachen Verstand zu versteckt;
nur die äusserste Sorgfalt und Aufmerksamkeit eines philosophischen Geistes
kann sie entdecken und bemerken. Die Tiere werden deshalb bei diesen Folgerungen
nicht durch Vernunftgründe geleitet, so wenig wie die Kinder und die
meisten Menschen; bei ihren gewöhnlichen Handlungen und Folgerungen, ja selbst
die Philosophen nicht, welche für den tätigen Teil des Lebens sich in der
Hauptsache von der Menge nicht unterscheiden und nach gleichen Regeln
verfahren. Die Natur musste für ein breiteres, allgemeiner anwendbares und
nutzbares Prinzip sorgen, und ein Verfahren von so ungeheurer Wichtigkeit für
das Leben konnte nicht den unsichern Folgerungen aus Gründen und Beweismitteln
anvertraut werden. Sollte dies bei dem Menschen noch zweifelhaft sein, so ist
es doch bei der unvernünftigen Schöpfung unfraglich, und wenn dieser Satz in
dem einen Falle vollständig gelten muss, so hat man nach den Regeln der
Analogie allen Grund, zur Annahme, dass er allgemein und ohne Ausnahme und
Vorbehalt gelte. Nur die Gewohnheit ist es, welche die Tiere veranlasst, bei jedem
wahrgenommenen Gegenstande dessen gewöhnlichen Begleiter zu erwarten; diese
führt ihr Vorstellen bei dem Auftreten des Einen zur Vorstellung des Andern in
der besondern Weise, welche ich Glauben nenne. Keine andere Erklärung
ist von diesem Vorgange möglich, und dieses gilt sowohl für die hohen, wie
niedern Klassen der lebendigen Wesen, so weit wir sie kennen und beobachten.A7
Obgleich indess die
Tiere einen grossen Teil ihres Wissens durch Erfahrung erlangen, so verdanken
sie doch einen andern Teil der ursprünglichen Verleihung der Natur. Er ist der, welcher den Grad ihrer
Fähigkeiten für gewöhnliche Fälle übersteigt, und wo die längste Übung und
Erfahrung sie wenig oder gar nicht weiter bringt. Man nennt diesen Teil Instinkt und
bewundert ihn als etwas Ausserordentliches, was durch keine Untersuchung unseres
Verstandes erklärt werden kann. Indess wird diese Bewunderung vielleicht
aufhören oder sich vermindern, wenn man bedenkt, dass das Folgern aus
Erfahrung, was wir mit den Tieren gemein haben, und von welchem alles Verhalten
im Leben abhängt, nur eine Art von Instinkt oder mechanischer Kraft ist, welche
in uns, und zwar uns selbst unbewusst, tätig ist und in seiner Hauptwirksamkeit
nicht durch solche Beziehungen und Vergleichungen der Begriffe geleitet wird,
welche den eigentlichen Gegenstand unserer geistigen Fähigkeiten ausmachen. Die
Instinkte sind vielleicht verschieden; aber es ist ein Instinkt, welcher den Menschen
heisst, das Feuer zu meiden, wie es ein Instinkt ist, welcher dem Vogel die
richtige Art des Brütens und die Einrichtung und Ordnung in Aufziehung seiner
Jungen zeigt. A7 Wenn alles Folgern
von Tatsachen oder Ursachen sich nur auf Gewohnheit stützt, so entsteht die
Frage, weshalb die Menschen die Tiere im Begründen so übertreffen, und weshalb
ein Mensch hierin den andern übertrifft? Die gleiche Gewohnheit müsste doch den
gleichen Einfluss auf Alle haben!Ich will hier kurz den grossen Unterschied in
dem Verstande der einzelnen Menschen erklären; daraus ergibt sich dann leicht
der Grund für denselben Unterschied zwischen Menschen und Tieren.
1. Wenn man einige Zeit gelebt und
sich an die Gleichförmigkeit der Natur gewöhnt hat, so neigt man dann allgemein
dazu, das Bekannte auf das Unbekannte zu übertragen und letzteres als dem
erstern gleich vorauszusetzen. Vermittelst dieser allgemeinen Neigung genügt
schon ein Experiment für die Folgerung, und man erwartet mit grosser
Gewissheit den gleichen Erfolg, wenn der Versuch genau und frei von allen
ungehörigen Nebenumständen vorgenommen worden ist. Die Beobachtung der Folgen
der Dinge istdeshalb eine Sache von grosser Wichtigkeit, und da ein Mensch den
andern in Aufmerksamkeit, Gedächtniss und Beobachtung übertrifft, so macht dies
für ihre Folgerungen einen grossen Unterschied.
2. Wenn mehrere Ursachen zur
Hervorbringung einer Wirkung zusammenwirken, so ist ein Verstand umfassender
als der andere und fähiger, den ganzen Zusammenhang der Gegenstände zu
begreifen und ihre Folgen richtig abzuleiten.
3. Einer kann die Kette der Schlüsse
weiter ziehen als der Andere.
4. Wenige Menschen können lange
denken, ohne die Vorstellungen zu verwirren und zu verwechseln, und diese Schwäche
hat ihre verschiedenen Grade.
5. Der Umstand, von dem die Wirkung
abhängt, ist oft in andern, anscheinend fremden und äusserlichen Umständen
verhüllt; seine Trennung erfordert oft grosse Genauigkeit, Aufmerksamkeit und
Scharfsinn.
6. Einzelne Beobachtungen gleich zu
allgemeinen Regeln zu erheben, ist ein angenehmes Geschäft, und es ist sehr
häufig, dass man aus Hast oder Geistesbeschränktheit die Sache nicht allseitig
betrachtet und deshalb in Missgriffe gerät.
7. Wenn die Analogie bei den Folgerungen
benutzt wird, so ist der im Vorteil, der das Meiste erfahren hat oder am
geschicktesten in Auffindung von Ähnlichkeiten ist.
8. Vorurteile, Erziehung, Gefühle,
Parteiungen beirren den Einen mehr als den Andern.
9. Nachdem man Vertrauen in
menschliches Zeugniss gewonnen hat, erweitern Bücher und Unterhaltung den
Gesichtskreis des Einen in seinem Wahrnehmen und Denken mehr als den des
Andern.
So liessen sich noch manche andere
Umstände auffinden, aus welchen der Unterschied in den Verstandeskräften der Einzelnen
hervorgeht.
The Aberdeen Bestiary
The Bodleian Library Bestiaries
Animal Lore in French Medieval Manuscripts
Physica: Zoologie
Speculum arabicum
Conrad Gessners Tierbücher
AnimalBase: Early Zoological Literature online
Tierische
Sternbilder: BSB Clm 210
Tiere als Attribute
von Heiligen
Von Karl Veitschegger © 2001
Tier
Heilige mit Gedenktag
Adler
Evangelist Johannes 27.12, Medard
8.6., Priska von Rom 18.1., Theoderich (Dietrich) v. Mont d´Or 1.7., Vitus
15.6.,
Bär/Bärin
König Edmund 20.11., Gallus
16.10., Kolumba 31.12., Kolumban 23.11., Korbinian 8.9 u.20.11., Landrada
8.7., Richardis 18.9., Romedius 15.1., Thekla 23.9., Vedast 6.2.
Biene/Bienenkorb
Ambrosius
7.12., Bernhard v. Clairvaux 20.8., Johannes Chrysostomus 13.9. , Maria
Mutter Jesu 8.12.,15.8. etc.
Delphin
Petronilla 31.5.
Drache
Beatus 9.5., Cyriakus 8.8.,
Eucharius v. Trier 9.12., Georg 23.4., Germanus v. A. 31.7., Hilarius 13.1.,
Honorat 16.1., Leo d. Große 10.11., Magnus 6.9., Margareta v. Antiochien
20.7., Mennas 11.11., Narzissus v. Gerona 29.10, Olaf Haraldson 29.7.,
Servatius 13.5., Silvester 31.12., Wilhelm v. Aquitanien 28.5.
Einhorn
Agatha 5.2.,
Firmin 25.9., Gebhard v. Salzburg 15.6. , Justina v. Padua 7.10., Maria
Mutter Jesu, Sturm(i) 16.12.
Ente
Brigida v. Meath 1.2.
Esel
Antonius v. Padua 13.6. , Brun v.
Querfurt 9.3., Gerold v. Groß-Walsertal 19.4., Sola 5.12.
Falke
Bavo (Allowin) 1.10., Jeron 17.8.
Fisch
Amalberg 8.7., Antonius v. Padua
13.6. , Arnulf 18.7., Benno v. Meißen 16.6., Bertold 27.7., Prophet Jona
21.9., Apostel Petrus 29.6., Erzengel Raphael 29.9., Ulrich v. Augsburg 4.7.,
Verena 1.9., Waltger 16.11.
Frosch
Pirmin 3.11.
Gans
Brigida v.
Meath 1.2., Martin v. Tours 11.11.
Greif
Himer 13.11.
Hahn
Odilia
13.12., Apostel Petrus 29.6., Valentin v. Terni 14.2., Vitus 15.6.
Hase
Rosa v. Lima 23.8., Vitus 15.6.
Hirsch
Eustachius 20.9. , Germanus 31.7.,
Hubertus 3.11., Idda v. Toggenburg 3.11., Katharina (Karin) v. Schweden
24.3., Meinolf 5.10. , Prokop 25.3.
Hirschkuh
Genovefa 3.1., Goar 21.7., Ida v.
Herzfeld 4.9.
Hund
Ägydius 1.9., Benignus 17.2.,
Bernhard v. Clairvaux 20.8., Eucharius v. Trier 9.12., Gottfried v. Amiens
8.11., Heinrich Seuse 23.1., Hubertus 3.11., Margareta v. C. 22.2., Robert v.
Newminster 7.6., Rochus 16.8.
Kamel
Drei Könige (Kaspar, Melchior,
Balthasar) 6.1., Mennas 11.11.
Katze
Gertrud v. Nivelles 17.3.
Kranich
Burkhard 18.5.
Krokodil
Theodor v. Euchatia 9.11.
Kuh
Berlind 3.2., Felizitas 7.3.,
Gunthildis 22.9., Leonhard 6.11., Patrick 17.3., Perpetua 7.3.
Lamm/Schaf
Agnes 21.1.,Coleta Boillet 6.3.,
Gezelin 6.8., Giselbert v. Schottland 1.10., Hartmann 12.12., Johannes der
Täufer 24.6., Karlmann 17.8., Klemens v. Rom 23.11., Lantpert 18.9., Medard
8.6., Paschalis Baylon 17.5.
Lerche
Coleta Boillet 6.3.
Löwe
Agapitus 6.8., Chrysanth 25.10.,
Prophet Daniel 21.7., Daria 25.10., Felizian 9.6., Gertrud v. Altenberg
13.8., Hieronymus 30.9., Ignatius v. Antiochien 17.10., Evangelist Markus
25.4., Martina 30.1., Pantaleon, Paulus v. Thebais 10.1., Simson, Polykarp
23.2., Primus 9.6., Thekla 23.9., Vitus 15.6.
Maultier
Franziska v. Rom 9.3.
Mäuse
Gertraud v. Nivelles 17.3., Martin
v. Porres 3.11.
Nachtigall
Rosa v. Lima 23.8.
Ochse
Sebald 19.8., Guido v. Anderlecht
12.9., Leonhard 6.11., Patrick 17.3.
Pfau
Liborius v. Le Mans 23.7.
Pferd
Hippolyt 13.8., Isidor der Bauer
15.5., Jeanne d`Arc (Johanna) 30.5., Ladislaus v. Ungarn 29.7., Martin v.
Tours 11.11., Mennas 11.11., Wendelin 20.10
Rabe
Benedikt v. Nursia 11.7., Idda v.
Toggenburg 3.11., Meinrad 21.1., Paulus v. Thebais 10.1.
Reh
Germanus 31.7.
Schlange
Amandus
6.2., Adam und Eva 24.12., Benedikt 11.7., Christina v. Bolsena 24.7.,
Hilarius 13.1., Hilda v. Whitby 17.11., Apostel Johannes 27.12., Patrick
17.3., Pirmin 3.11., Silvester 31.12., Thekla 23.9.
Schwein
Antonius der Einsiedler 17.1.,
Blasius 3.2., Mono 18.10., Wendelin 20.10
Skorpion
Demetrius 8.10.
Spinnen
Konrad v. Konstanz 26.11.
Stier
Blandina 2.6., Isidor der Bauer
15.5., Leonhard 6.11., Evangelist Lukas 18.10., Saturnin (Serin) 29.11.,
Silvester 31.12., Theopompus 3.1., Wendelin 20.10
Taube
David v. Menevia 1.3., Dominikus
8.8., Eduard der Bekenner 13.10. , Fabian 20.1., Gregor d. Große 3.9., Gregor
v. Nazianz, Hadelin 2.1., Julia v. Karthago 22.5., Joachim Vater Mariens
26.7., Johanna Maria Bonomo 22.2., Johannes Chrysostomus 13.9., Konstantia
18.2., Kreszentia Höß 5.4., Kunibert 12.11., Mechthild v. Hackeborn 19.11.,
Medard 8.6., Noah, Oda v. Brabant 27.11., Paulinus v. Trier 31.8., Polykarp
23.2., Regina v. Burgund 7.9., Remigius 1.10., Scholastika 10.2., Severus
1.2., Theresia v. Avila 15.10, Thomas v. Aqin 28.1., Papst Zacharias 15.3.
Vögel
Gamelbert 17.1., Hilda v. Whitby
17.11., Franz v. Assisi 4.10
Wildgänse
Amalberg 8.7., Liudger 26.3.
Wolf
Arnulf 18.7., Blasius 3.2., König
Edmund 20.11., Poppo 19.7., Radegundis v. W. 18.7., Remaklus 3.9., Sola
5.12., Sintpert v. Murbach 13.10., Vedast 6.2., Wolfgang 31.10
Tierepos
I. ALLGEMEIN. MITTELLATEINISCHE,
DEUTSCHE UND ROMANISCHE LITERATUR
Das Tierepos
als Gattung ist keinesfalls aus der antiken Epenparodie mit animal.
Protagonisten Froschmäusekrieg
ableitbar, sondem eine Erndung des MA, ein Produkt der Wechselwirkung von
gelehrt-schriftl. und volkstüml. Tradition und des germ.-roman. Kulturkontaktes
im (ehemal.) karolingischen Mittelreich Lotharingien. Es ist ein
Episodengedicht, bestehend aus einzelnen, einer mehr oder minder kohärenten
epischen Gesamtstruktur eingefügten Tierschwänken. Der Tierschwank
unterscheidet sich von der abstrakteren und lehrhafteren Fabel durch ein
Mehr an illustrativer Ausschmückung, Belebung des Raumes, Plastizität der
Akteure, Kontingenz und v. a. Komik der Handlung. Da es sich hier nur um eine
graduelle Differenzierung handelt, kennen die meisten Schwänke des jeweiligen Tierepos
auf Fabeln und weit seltener auf Motive anderer Gattungen (Mythos, Märchen,
Naturkunde etc.) zurückgeführt werden und sich umgekehrt bei Neubearbeitung der
Fabelgattung durchaus wieder annähern (so im Reinhart Fuchs). Selbst kaum schwankhaft umgestaltete ,originale'
Fabeln nden neben den Schwänken im T. ihren Platz. Obwohl der Tierschwank der Allegorie noch ferner steht als
die Fabel, die ihrerseits schon als ktive Erzählung (fabula im Sinne der christlichen Poetik und Hermeneutik) in
Ermangelung eines sensus spiritualis
an sich keiner Allegorese zugänglich ist, schreckt man gelegentlich auch vor
einer solchen nicht zurück, auch nicht im spätma. Tierepos.
Den
stofflichen, seit dem 9. Jh. schriftl. überlieferten Kern der ältesten Tierepen
bildet das Motiv vom Hoftag des (kranken) Löwen, ein Motiv, dessen Herkunft
(aus der
äsopischen
Fabel oder aus mündl., vielleicht germ. Erzählgut?) und ursprgl. Gestalt nicht
gesichert sind. Es liegt der Binnenerzählung der Ecbasis cuiusdam captivi zugrunde, liefert aber ebenso wie deren Außenfabel
vom geohenen und durch den Wolf verlockten Kalb nur das eher magere pseudo-epische
Skelett für eine sprunghafte Aneinanderreihung zoomorpher Abbilder menschlichen Fehlverhaltens. Damit steht
die Ecbasis einer Verssatire wie dem Speculum stultorum des Nigellus de Longo
Campo (1179/80), die freilich nicht nur auf epische Kontinuitiit, sondern auch
aufdurchgängige Verwendung echten Tierpersonals verzichtet, näher als dem ersten
T. im engeren Sinne, dem Isengrimus
von ca. 1148/49. Dieser entstammt wie die Ecbasis
dem monastischen Milieu und macht nun neben der Hoftagsfabel das frühma., in
der Fecunda ratis Egberts v. Lüttich
(ca. 1023) erstmals ausdrücklich belegte und auch in der Ecbasis erwähnte Motiv vom Wolf als Mönch zum zweiten Kristallisationspunkt
einer die 24 Episoden einigermaßen integrierenden epischen Gestaltung.
Generell
dominiert im T. die gegenbildliche Komik, welche aus der persiflierenden
Inversion von Texten, Handlungen, Gebräuchen aus anderen lit. Gattungen und
anderen kulturellen Kontexten entsteht. Im Isengrimus
herrscht sie allein und entstammt ganz überwiegend dem klerikalen Bereich
(Bibel, Liturgie, Legende etc.), dagegen im ersten volkssprachlichen T., den ältesten
Branchen des afrz. Roman de Renart
aus dem späteren 12. Jh., vorwiegend dem hösch-ritterl. Milieu (Heldenepos,
Roman, Min- nesang), ebenso dann in den anschließnden mhd., mittelenglischen.
und mndl. Bearbeitungen. Das Kernmotiv vom Hoftag des Löwen wird auch hier
aufgegriffen, aber zur Satire auf die Hofgerichtsbarkeit umgeformt. Das
Schwankhafte des Renart vererbt sich
am stärksten dem mndl. T. Van den Vos
Reynaerde (Mitte 13. Jh.?), das ande- ren ,grotesken' Formen der Komik am
ehesten Eingang gewährt. Daneben dringen aber auch geistl. Elemente wieder stärker
ein, um so mehr dann in die spätma. Fortsetzungen und Ableger. Das Publikum
weitet sich nun auf mehrere Stände aus, zuerst allmählich z.B. bei Jacquemart Giélée aus Lille, oder im
umfangreichen Renart le Contrefait
eines Klerikers aus Troyes (1319-40), dann aber vermehrt mit den ersten
Drucken, insbes. dem volksseelsorgerisch genutzten mnd. Reynke de Vos von 1498 und der Umarbeitung in mndl. Prosa 1479
(Gouda) bzw. 1485 (Delft). Auf dem Goudaer Druck beruht auch die me. Übersetzung
von Caxton (Westminster 1481), während man zuvor im Mittelenglischen nur
einzelne Tierschwänke des Roman de Renart
bearbeitet hatte. Kaum ein anderes lit. Erbe des MA ist auch noch im neuzeitlichen
Europa so eifrig und getreu bewahrt worden wie das Tierepos.
F. P.
Knapp
Aus: Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII
(gekürzt)
Neuer Absatz
Ich möchte Sie auf eine Internetseite der Universität Mainz hinweisen, die mancherlei Material für unser Seminar bereit hält:
https://www.animaliter.uni-mainz.de/die-lexikon-seite/
Augustinus
"Man darf nicht daran zweifeln, dass das
entgegengesetzte Streben der guten und bösen Engel nicht in der Verschiedenheit
ihres Wesens und Ursprungs begründet ist, da Gott, der gute Urheber und Schöpfer aller Wesen, sie beide geschaffen
hat, sondern in der Verschiedenheit
ihres Wollens und Begehrens. Denn die einen verharren standhaft bei dem
allen gemeinsamen Gut, das für sie Gott selber ist, und bei seiner Ewigkeit,
Wahrheit und Liebe; die andern, von ihrer eigenen Macht berauscht, fielen, als
könnten sie ihr eigenes Gut sein, von dem höheren, allen gemeinsamen,
beseligenden Gute auf sich selbst zurück, tauschten dünkelhafte
Selbstüberhebung ein für die hoch erhabene Ewigkeit, nichtsnutzige Schlauheit
für gewisseste Wahrheit, parteiische für allgemeine Liebe und wurden
hochmütig, trügerisch, neidisch. Gott anhangen, das ist für die einen Grund
der Seligkeit, so ergibt sich als Grund der Unseligkeit der anderen das
Gegenteil: Gott nicht anhangen. Wenn also auf die Frage, warum die einen selig
sind, die Antwort mit Recht lautet: Weil sie Gott anhangen, und auf die Frage,
warum die andern unselig: Weil sie Gott nicht anhangen, so gibt es für die mit Vernunft und Geist begabte Kreatur kein anderes
Gut, das selig machen kann, als Gott allein. Also, obschon nicht alle Geschöpfe glückselig sein können - denn wilde
Tiere, Bäume, Felsen und dergleichen erlangen diese Gnadengabe nicht, sind auch
nicht empfänglich dafür -, sind es doch diejenigen, die es sein können, nicht aus
sich selbst, da sie aus nichts geschaffen sind, sondern durch den, der sie
geschaffen hat. Gewinnen sie ihn, sind sie selig, verlieren sie ihn,
unselig. Er aber, der durch kein anderes Gut, sondern durch sich selbst selig
ist, kann darum nie unselig sein, weil er nie sich selbst verlieren kann.
Wir sagen also: Es gibt nur ein unwandelbares Gut, den
einen, wahren, seligen Gott; dagegen, was er geschaffen hat, ist zwar gut, weil
es von ihm stammt, doch auch wandelbar, weil es nicht aus ihm, sondern aus nichts
erschaffen ist. Obschon sie also nicht zuhöchst gut sind, da Gott ein höheres
Gut ist als sie, stellen darum doch auch die wandelbaren Geschöpfe ein hohes
Gut dar, da sie dem unwandelbaren Gut anhangen können, um selig zu sein. Denn
dies ist für sie so sehr das Gut, dass sie ohne es notwendig unselig sein
müssen. Und nicht etwa sind in der Gesamtheit der Schöpfung andere Wesen darum
besser, weil sie nicht unselig sein können, sonst müssten ja die übrigen
Glieder unsers Körpers darum besser sein als die Augen, weil sie nicht
erblinden können. Aber wie ein
empfindendes Geschöpf, auch wenn es Schmerzen leidet, besser ist als ein Stein,
den nichts schmerzt, so ist ein vernünftiges Wesen, mag es auch unselig sein,
vorzüglicher als ein Wesen, das keine Vernunft, vielleicht auch keine
Empfindung besitzt und darum für Unseligkeit nicht empfänglich ist."
Aus: Vom Gottesstaat, 12,1
Thomas von Aquin
"Keiner sündigt, indem er eine Sache zu dem verwendet,
wozu sie bestimmt ist. In der Ordnung
der Wesen aber sind die
unvollkommenen wegen der vollkommenen da; wie auch die Natur beim Vorgang der
Zeugung vom Unvollkommenen zum Vollkommenen fortschreitet. Wie daher bei
der Zeugung des Menschen zuerst das Lebewesen, dann das Sinnenwesen, zuletzt
der Mensch da ist [23], so sind auch die Wesen,
die nur Leben haben, wie die Pflanzen, im allgemeinen für alle Tiere
da, und die Tiere für den Menschen. Wenn deshalb der Mensch die Pflanzen
gebraucht für die Tiere und die Tiere zum Nutzen des Menschen, so ist das nicht
unerlaubt; wie das auch aus dem Philosophen erhellt (Aristoteles, B.K.).
Unter den verschiedenartigen Verwendungsmöglichkeiten nun scheint jener
Gebrauch am meisten notwendig zu sein, bei
dem die Tiere sich der Pflanzen, die Menschen sich der Tiere zur Nahrung bedienen,
was nicht ohne Tötung jener geschehen kann. So ist es denn erlaubt, sowohl
die Pflanzen zu töten zur Nahrung für die Tiere als auch die Tiere zur Nahrung
des Menschen, und zwar auf Grund der
göttlichen Ordnung. Denn so heisst es Gn l,29f.: "Sehet, Ich habe euch
alles Kraut und alle Bäume gegeben, dass sie euch und allen Tieren zur Nahrung
seien." Und Gn 9,3 heisst es: "Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur
Speise dienen." Die heilige Liebe ist nach dem Gesagten (23,1) eine Art
Freundschaft. Kraft der Freundschaft aber liebt man einmal den Freund, mit dem
man Freundschaft hat; und dann die Güter, die wir dem Freunde wünschen. In der
ersten Weise kann kein vernunftloses Geschöpf aus heiliger Liebe geliebt
werden. Und das aus einem dreifachen Grunde. Zwei dieser Gründe beziehen sich allgemein auf die Freundschaft, die
man mit den vernunftlosen Geschöpfen nicht eingehen kann. Und der erste
ist, weil wir Freundschaft nur mit dem haben, dem wir Gutes wollen. Im eigentlichen Sinne aber kann ich dem
vernunftlosen Geschöpfe nicht Gutes wollen, denn es ist nicht seine Sache, ein
Gut zu besitzen, sondern nur Sache des vernunftbegabten Geschöpfes, das Herr
ist über den Gebrauch des Gutes, das es kraft des freien Wahlvermögens besitzt.
Deshalb sagt der Philosoph, dass wir bei diesen Wesen nur bildhaft davon
sprechen, dass ihnen etwas Gutes oder Böses zustösst. - Zweitens, weil jede
Freundschaft in irgendeiner Lebensmitteilung gründet. "Denn nichts eignet der
Freundschaft mehr als das Zusammenleben" (Aristoteles).
Die vernunftlosen Geschöpfe aber können keine Gemeinschaft haben mit
dem menschlichen Leben, das sich nach der Vernunft vollzieht. Daher kann man zu den vernunftlosen
Geschöpfen keinerlei Freundschaft haben als höchstens in übertragenem Sinne.
-
Der dritte Grund ist der heiligen Liebe ganz eigentümlich: weil die heilige
Liebe in der Mitteilung der ewigen Seligkeit gründet, deren das vernunftlose
Geschöpf gar nicht fähig ist. Deshalb
kann man die Freundschaft der heiligen Liebe mit den vernunftlosen Geschöpfen
nicht haben.
Jedoch können die vernunftlosen Geschöpfe
mit der heiligen Liebe geliebt werden wie die Güte, die wir anderen wollen; sofern wir aus der heiligen Liebe heraus wollen, dass sie zur Ehre Gottes und zum Nutzen der
Menschen erhalten werden. Und so liebt auch Gott sie mit heiliger Liebe
[vgl. 1 20,2 Zu 3: Bd. 2]."
Aus:
Thomas von Aquin, Summa Theologiae IIa-IIs q. 25, art. 3.
 Neuer Absatz Neuer Absatz
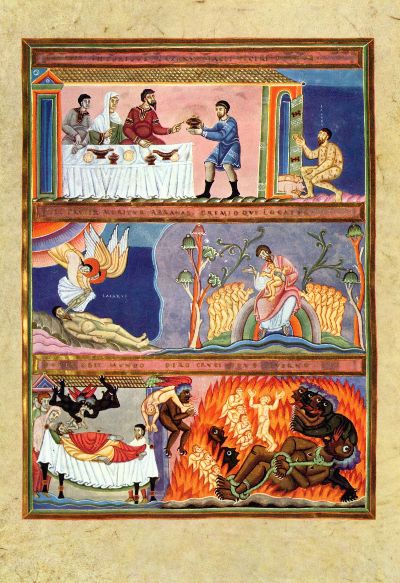 Zur symbolischen bzw. zeichenhaften Bedeutung des
Hundes in der mittelalterlichen Tierinterpretation
Die Bedeutung, die der Hund für die Jagd besaß, hat
sich in vielen Sprichwörtern
niedergeschlagen. Es gibt eine Unzahl von Redewendungen, die den Hund auf
diesen Lebensbereich beziehen. So heißt es von einem Menschen, der sich schlau
allen Gefahren zu entziehen weiß, er sei <mit allen Hunden gehetzt>. Wer
nicht auf sich aufmerksam machen will, sondern ein Interesse daran hat, im
Verborgenen zu bleiben, möchte keine <schlafenden Hunde wecken). Der
Ausdruck (vor die Hunde gehen) könnte aus der Jägersprache hergeleitet sein und
sich auf krankes, schwaches Wild beziehen, das leicht den Jagdhunden zum Opfer
fällt, wenn nicht ganz allgemein die Geringschätzung des Hundes zur Bildung
dieser Metapher geführt hat. Aus der unendlichen Fülle der Beispiele seien hier
nur noch einige wenige herausgegriffen: «Alter Hund macht gute Jagd; den letzten
beißen die Hunde; ein bellender Hund taugt nicht zur Jagd; es ist ein
schlechter Hund, den man zur Jagd tragen muß» und «viele Hunde sind des Hasen
Tod.»
Zur symbolischen bzw. zeichenhaften Bedeutung des
Hundes in der mittelalterlichen Tierinterpretation
Die Bedeutung, die der Hund für die Jagd besaß, hat
sich in vielen Sprichwörtern
niedergeschlagen. Es gibt eine Unzahl von Redewendungen, die den Hund auf
diesen Lebensbereich beziehen. So heißt es von einem Menschen, der sich schlau
allen Gefahren zu entziehen weiß, er sei <mit allen Hunden gehetzt>. Wer
nicht auf sich aufmerksam machen will, sondern ein Interesse daran hat, im
Verborgenen zu bleiben, möchte keine <schlafenden Hunde wecken). Der
Ausdruck (vor die Hunde gehen) könnte aus der Jägersprache hergeleitet sein und
sich auf krankes, schwaches Wild beziehen, das leicht den Jagdhunden zum Opfer
fällt, wenn nicht ganz allgemein die Geringschätzung des Hundes zur Bildung
dieser Metapher geführt hat. Aus der unendlichen Fülle der Beispiele seien hier
nur noch einige wenige herausgegriffen: «Alter Hund macht gute Jagd; den letzten
beißen die Hunde; ein bellender Hund taugt nicht zur Jagd; es ist ein
schlechter Hund, den man zur Jagd tragen muß» und «viele Hunde sind des Hasen
Tod.»
Das Mittelalter hat die Jagd jedoch nicht
nur real und den Hund nicht nur als wirklichen Jagdhund betrachtet, den man
züchten, pflegen und wegen seiner Kostbarkeit gut behandeln mußte.
Es hat die Jagd auch allegorisiert und damit mit einer
geistigen bzw. geistlichen Bedeutung versehen. In diesem Sinne schreibt z.
B. Hadamar von Laber (1300 - 1360)* um
1340 ein Minnegedicht in Form einer Allegorie: Am Leitseil den Hund
<Herze> reitet ein Jagdherr aus, um einem edlen Wild, der Minne,
nachzujagen. Knechte führen die Hunde (Freude,
Wille, Wonne, Trost, Beständigkeit, Treue, Harro und viele andere mit. Nach
vielen Gefährdungen und Rückschlägen gelingt es dem Jäger, das Wild zu stellen.
Aber die Wölfe, die böse Gesellschaft,
schlagen die Hunde in die Flucht. Und da der Jäger zögert, den Hund
<Ende>, die Sinnlichkeit, auf das Wild zu hetzen, bleibt ihm zum Schluß
nur die Hoffnung, daß die Hunde <Treue> und <Harre> ihn schließlich
doch noch zu seinem Ziel führen.
·
https://archive.org/details/hadamarsvonlabe00stejgoog
Die symbolische bzw. zeichenhafte Bedeutung des
Hundes, die im Mittelalter neben seiner realen Funktion als überaus wichtig
galt, ergab sich aus der Tatsache, daß
die Tiere im christlichen Bereich im bevorzugten Maße in das Licht einer
geistlichen Sinnauslegung traten. Sie geht allgemein auf biblische
Traditionen, im Besonderen aber auf den Physiologus, die Hauptschrift der
christlichen Natursymbolik zurück, einer Schrift des vierten (?) nachchristlichen
Jahrhunderts, in der die Tiere zumeist auf Christi
Heilstaten hin ausgelegt werden. Die Eigenschaften oder Verhaltensformen
der Tiere werden hier in ein Analogieverhältnis gebracht zu Eigenschaften oder
Verhaltensweisen der höheren Wesen, zu denen sie in Beziehung gesetzt werden;
Zeichen und Bezeichnetes gehören also unterschiedlichen Ebenen an.
Der Physiologus
hat neben der Bibel die wohl größte
Verbreitung gefunden und die gesamten
Tiervorstellungen des Abendlandes entscheidend mitgeprägt: wo immer im
Mittelalter Tiere erscheinen, ob in den Bestiarien, den Tierbüchern jener Zeit,
oder in der philosophischen oder geistlichen Tierauslegung, in Predigten oder
in der Homiletik, in den Moral- oder Naturlehren, in literarischen Texten oder
auf bildlichen Darstellungen, immer ist seit dem Physiologus mitzudenken, daß das Tier nicht nur einen literalen Sinn besitzt. Es meint also nicht nur,
was es real ist, sondern dieser literale Sinn verschlüsselt den eigentlichen, den allegorischen Sinn; dem
Interpreten kommt mithin die Aufgabe zu, den eigentlichen Sinn herauszufinden und zu verstehen.
Seltsamer- oder auch bezeichnenderweise findet sich im
Physiologus kein eigener Abschnitt über den Hund. Das ist merkwürdig, da es
sich damals schon um eines der wichtigsten und verbreitetsten Tiere gehandelt
haben dürfte. Aber vielleicht fehlt der Hund gerade aus diesem Grund. Auf jeden
Fall hat die Tatsache, daß der Hund im Physiologus
übergangen wurde, dem Hundebild nicht
die Konstanz und Festigkeit gegeben, die andere Tiere in der
Auslegungstradition erhielten.
Das allegorische Hundebild ist vielfältig und daher
etwas schillernd.
Betrachten wir einige der zahllosen Auslegungen, in
denen Dinge, die vom Hund gesagt werden, mit geistlichem Sinn gefüllt werden.
In einem alttestamentarischen
Weisheitsspruch (Prov. 26,11) heißt es vom Hund, daß er
seinen eigenen Auswurf wieder auffrißt.
Die allegorische Auslegungstradition versteht das so: der Hund bezeichnet dadurch denjenigen Menschen, der, kaum daß er seine
Sünden aufgegeben hat, wieder rückfällig wird.
Oder es heißt vom Hund, daß er mit seiner Zunge Wunden heilt; der allegorische Sinn: der Priester soll die Menschen mit Trost,
nicht mit Schrecken heilen.
Oder: ein eingeschlossener Hund winselt und möchte
gerne heraus zu seinem Herrn; in der Schriftauslegung
erhält das folgenden Sinn: die guten eistlichen Menschen rufen zu Gott und
warten darauf, daß sie von dieser Welt scheiden können.
In einem alten englischen Bestiarium des
12.Jahrhunderts wird ein Hund abgebildet, der für den gespiegelten Kuchen in
einem Teich den Kuchen, den er im Maul hält, fallen läßt und ins Wasser
springt, womit jene törichten Menschen gemeint sind, die einen realen Besitz für etwas Unbekanntes eintauschen. Zwei Hunde,
die ihre Wunden lecken, um sie zu heilen, repräsentieren die Sünder, deren
Sünden vergeben werden, wenn sie vor Gott in der Beichte offenbart werden.
Überblickt man die vielen Auslegungsinhalte, so sieht
man schnell, daß der Hund keineswegs
einheitlich beurteilt bzw. bewertet wurde. Vielmehr lassen sich deutlich negative von positiven Sinngebungen
unterscheiden.
In den negativen wirkt eine Interpretationsgeschichte
nach, die den Hund von jeher mit dem
Schlechten und Gemeinen, dem Wertlosen und Unedlen, mit magischen Praktiken und
Aberglauben, mit dämonologischen Vorstellungen und satanischen Phantasien in
Verbindung brachte, wie sie seit der Antike vertraut sind: etwa im Bild des
Tradition des Abendlandes einen gewaltigen Einfluß gewann, wird der Hund zum Vergleich einem von Lastern entstellten
Menschen an die Seite gestellt: «Wild und unruhig übt er seine Zunge in
Zänkereien; du magst ihn mit einem Hund vergleichen».
Daran konnte die monastische Literatur und zumal die geistliche Rhetorik der Predigt anknüpfen,
wenn sie in ihren Jagdallegorien den Hund mit den Hauptsünden in Beziehung
setzte: noch bei dem Mystiker Tauler, also im
14.Jahrhundert, verkörpern die größeren Hunde die sieben Hauptsünden, die
kleineren die geringeren Unvollkommenheiten. Als widergöttliche dämonische
Mächte erscheinen die Jagdhunde in einer anonymen Jagdpredigt des 14.
Jahrhunderts. Relikte des dunkel-mythischen Hundebildes finden sich auch in
der hagiographischen Legende, dort wo
der Hund, wie etwa in der Andreaslegende, als Teufel bzw. der Teufel im Hund
erscheint.
Auch in vielen der bis heute noch geläufigen negativen
Sprichwörter mag diese Tradition der Auslegung nachwirken. Wenn wir von
jemanden sagen, er sei ,auf den Hund gekommen' oder ,gehe vor die Hunde', wenn
wir vom ,Hundeleben' sprechen oder vom ,verhunzen', wenn es im Mittelalter als
unehrenhafte Schandstrafe für Adlige galt, ,Hunde zu tragen' - so spricht dies
alles dafür, daß der Hund auch als etwas Minderwertiges,
Unedles, Verächtliches angesehen werden konnte. Hier scheint bereits jene
Bewertung des Animalischen zum Ausdruck zu kommen, die eine so entscheidende
Komponente des späteren Hundebildes darstellt, eine Bewertung, die beides
enthält: Anziehendes wie Abstoßendes, Abwehr wie Faszination.
Neben diesem negativen Bild steht jedoch
das positive, das sogar, aufs Ganze gesehen, das dominante ist.
Schon Isidor von Sevilla (570-636),
der bedeutsamste Vermittler antiken Gedankenguts, der mit seinen (Etymologien) dem Mittelalter ein
Grundwerk der lateinischen Kultur hinterließ, rühmte den Scharfsinn und das feine Unterscheidungsvermögen des Hundes, und
auch dieses Urteil hat in der Folgezeit nachgewirkt.
Wachsamkeit, Furchtlosigkeit, Klugheit und
Treue sind die Tugenden, die dem Hund vor allem zugeschrieben werden und die
das positive Tierbild bestimmen. So
wird der Hund als wachsamer Wächter zum Bild für den Prediger, und in diesem
Das Bild des Hundes als eines Predigers, das sich auf Jesaja 56,10 zurückbeziehen läßt, scheint zum ersten Mal in
der Pastoralregel des Kirchenvaters Gregor des Großen (Kap. IV) belegt zu sein. In der Parabel vom reichen
Prasser und armen Lazarus (Luk.
16,21) lesen wir:
«Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor
seiner Tür voller Schwären und begehrte, sich zu sättigen von dem, was von des
Reichen Tische fiel; dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine
Schwären.»
Nach Gregor dem Großen sind
mit den Hunden, deren Zunge Wunden durch Belecken heilt, die Prediger gemeint.
Auch die heiligen Lehrer berühren und heilen gleichsam mit ihrer Zunge
Seelenwunden, wenn sie auf ein Sündenbekenntnis hin die Menschen mahnen.
Daß auch einige Heilige
mit einem Hund abgebildet werden, findet in dieser Deutungstradition seine
Erklärung. So soll z. B. die Mutter Bernhards v. Clairvaux (1091-1153) vor seiner Geburt geträumt haben, sie
trüge ein bellendes, weißes Hündchen in ihrem Schoß, was folgendermaßen
gedeutet wurde: das Kind werde einmal ein treuer, wachsamer Hüter des Hauses
Gottes, der Kirche, und ein machtvoller Prediger des Heils. Ein ähnlicher
Traum ist von der Mutter des Dominikus überliefert:
sie gebäre einen Hund mit einer brennenden Fackel im Maul, der die ganze Welt
in Flammen setzen würde.
Der Kirchenvater Ambrosius hatte bereits im 4. Jahrhundert diese Auslegung
vorbereitet, indem er von allen
Christenmenschen die Wachsamkeit des Hundes gegenüber dem Herrn forderte.
Den Hunden sei die Dienstfertigkeit und die
ängstliche Wachsamkeit über die Wohlfahrt ihres Herrn gleichsam angeboren.
Daher seien die Pflichtvergessenen, Nachlässigen und Feiglinge unter den
Menschen gewissermaßen stumme Hunde, die nicht zu bellen verstünden. Wie der
Hund für seinen Herrn zu bellen bereit sei, so müsse auch der Mensch seine
Stimme für Christus erheben, wenn gefährliche Wölfe in die Höhle des Herrn
einbrechen.
Daß der heilige Rochus, der Pfleger und Patron der Pestkranken, einen Hund
bei sich hat, dürfte darauf zurückzuführen sein, daß die Legende erzählt, sein
Hund habe ihn mit Brot ernährt. Vielleicht spielt aber hier auch die
Lazarusgeschichte mit hinein. Zwar hat der Hund, der dem armen Lazarus
mitleidsvoll die Geschwüre leckte, für die mittelalterliche Allegorese kein fest
umrissenes Bezugsmodell geschaffen; doch es gibt eine Reihe von Texten, die in
diesem Hund und seinem Verhalten das Zeugnis heilenden Arztdienstes erblicken.
So heißt es in der Naturkunde der Hildegard
von Bingen (1098-1179), «die Wärme seiner Zunge
bringe Wunden und Geschwüren Heilung, wenn er sie mit seiner warmen Zunge
beleckt».
Und Konrad von Megenberg (um
1309-1374) nennt in seinem Buch der Natur,
der ersten Naturgeschichte in deutscher Sprache, die Zunge des Hundes
ausdrücklich <ain ärzetinne>.
Noch auf eine letzte symbolische Ausdeutung ist kurz
hinzuweisen. Wie der Löwe findet sich
auch der Hund sehr häufig auf Wappenbildern und besonders auch auf
Grabdenkmälern, meist zu Füßen des Verstorbenen.
Allgemein ist dies verstanden worden als Inkarnation der Treue, möglicherweise
läßt es sich aber auch konkreter
interpretieren als Symbol der Macht, wofür man beachtliche Gründe
beigebracht hat. Nach dieser Deutung
repräsentiert der Löwe die Hochgerichtsbarkeit, der Hund dagegen die niedere.
Hund wie Löwe kommen demnach nur dem Adel zu. Beide Tierbilder sind verbunden
mit gewissen durch Belehnung, Vererbung oder Verkauf übertragbaren Rechten,
beide beziehen sich also in dieser Ausdeutung auf gerichtliche Macht.
So
darf man sagen, daß das Hundebild, zum mindesten in der gelehrten Allegorie und
in den zahlreichen Tierbüchern im allgemeinen doch immer wieder auf wenige enge Schemata reduziert erscheint: negativ
ist er der schändliche, Todsünden repräsentierende, oft dämonische,
furchterregende, verächtliche Fresser seines eigenen Auswurfs; positiv dagegen
sieht man in dem wachsamen, treuen, mitleidigen Tier den Wächter, den Prediger,
den Lehrer, den Arzt, das Symbol gerichtlicher Macht.
Auf einem Bild Hans Memlings (1434-1494) erscheint ein Hund neben der Allegorie der Eitelkeit, die als nackte
Frau mit einem Spiegel dargestellt wird, bei der das Hündchen vielleicht dazu
dient, gerade ihre Luxuria und ihr oberflächlich-äußerliches Leben
hervorzuheben.
Ein jüngerer Zeitgenosse Memlings, Hieronymus
Bosch, der zwischen 1480-1516 gemalt hat,
greift, an der Schwelle zur Neuzeit, noch einmal die Vielfalt der allegorischen
Ausdeutungstradition auf. Bei ihm finden sich alle nur erdenklichen
Hundearten: gutmütige, naive Hunde bei den «Heiligen drei Königen» und der «Anbetung
der Hirten»; reizbare Geschöpfe bei der «Trägheit», einem Teil des «Garten der
Lüste»; apathische Hunde bei den Darstellungen des «verlorenen Sohnes»;
diabolische Tiere bei den «Versuchungen des heiligen Antonius» oder
aufmerksame und gelehrige Tiere wie das Hündchen mit dem Schellengeschirr, der
Narrenkappe und dem Questen- schwanz auf dem Bild vom Gaukler. Immer scheinen
sie zum Darstellungssinn der jeweiligen Episode etwas Wichtiges beizutragen,
unterstreichend, pointierend oder auch im kontrapunktischen Gegensinn. Dennoch
bleibt ihre Bedeutung im Einzelnen unklar, bizarr, kryptisch. Es kommt einem
vor, als habe der Maler noch einmal alle Varianten der Deutungstradition ausgenutzt,
ohne den Schlüssel für deren Erkenntnis mitzuliefern.
Nun könnte die allegorische
Auslegungstradition leicht dazu veranlassen, daß man übersieht, daß es auch im
Mittelalter bereits persönliche Beziehungen zwischen Mensch und Hund gab. Schon bei der Darstellung des Jagdbereiches zeigte
sich, welchen Wert der Hund für den Menschen besaß. Besonders war es aber die Literatur, die immer wieder engere Bindungsmöglichkeiten
beschrieb. So wird z.B. in dem Fragment des lateinischen Ritterromans Ruodlieb (um 1050) dem Hund durchaus
schon ein besonderer, fast liebevoller Platz eingeräumt:
Investigator (Aufspürer) und praecursor (Vorläufer)
heißt er, bicolor (gescheckt) ist er, trägt ein goldenes Halsband und darf beim
Empfang am Hof mit dabei sein.
Persönlichere Züge nimmt auch schon das Hundebild an,
das Hildegard von Bingen (1098-1179) entwirft: *
«Der Hund ist recht warm und hat in seiner Natur und
seinen Gewohnheiten etwas vom Menschen, liebt ihn, hält sich gern bei ihm auf
und ist ihm treu. Der Teufel haßt den Hund und schreckt vor ihm zurück wegen
der Treue, die er zum Menschen empfindet.
Der
Hund erkennt Feindseligkeit, Zorn und Unredlichkeit am Menschen und knurrt oft
deswegen. Und wenn er weiß, daß in einem Hause Feindseligkeit oder Zorn
herrscht, knirscht er mit den Zähnen und murrt.»
·
Hildegard von Bingen, Heilkraft der Natur = Physica. Das Buch von dem inneren Wesen der
verschiedenen Naturen der Geschöpfe. Erste vollständige, wortgetreue und
textkritische Übersetzung, übers. von Marie-Louise Portmann, Augsburg 1997.
Vorbereitet wurde diese persönlichere Zuwendung zum
Tier bereits lange zuvor durch die philosophisch-theologische Diskussion des
Mittelalters. Schon Johannes Eriugena (9. Jahrhundert) sprach den Tieren, deren
Bewegungen von den älteren Kirchenvätern nur als uneigenständig im Rahmen der
menschlichen Gottesorientierung verstanden wurden, eine unvergängliche Seele zu, weil ihre Regungen und Eigenschaften
darauf schließen ließen, daß sie in ihren Handlungen unmittelbar von Gott
abhängig seien und somit auch an seiner Ewigkeit Teil hätten.
Der Hund des Odysseus, so sagte Eriugena, erkannte
nach zwanzig Jahren seinen Herrn wieder, was auf eine besondere Kraft der Seele
deute.
Adelard von
Bath (12. Jahrhundert) hat diese Auffassung
später noch weiter entwickelt und mit Gründen untermauert. «Für die
Philosophen ist es völlig gewiß. Tiere haben Seelen» (zit. n. Nitschke, 247).
Und er belegt diese Behauptung durch das Beispiel des Hundes, der nicht nur
wahrnimmt, sondern aus dem Wahrgenommenen auch Schlüsse zieht. So läuft er
schnell davon, wenn er etwas erblickt, von dem er fürchtet, dieses möge ihm
schaden. Also kann er aufgrund des
Wahrgenommenen ein Urteil fällen; und das setzt eine Kraft in ihm voraus. Diese
Kraft kann aber nur die Seele sein. Ein Hund wird z. B., nachdem er eine Stimme
gehört hat, freiwillig seine gerade begonnene Handlungsweise aufgeben und das
ausführen, was die Stimme dem Hund befahl. Also muß der Hund die Stimme
verstanden haben. Verstehen kann aber ein Tier nur, wenn es über eine Seele
verfügt.
Thomas von Aquin hat im 13.Jahrhundert dieser
Auffassung widersprochen und damit eher die gängige Lehrmeinung formuliert.
Entscheidend sei, daß das Ziel der
Tierseele sich vom Ziel der menschlichen Seele unterscheide. Die Seele des Tieres strebe danach, als
lebendiger Körper bestehen zu bleiben, die menschliche Seele dagegen wünsche,
in die unkörperliche Ewigkeit zu gelangen.
Solcher rigorosen theologischen
Argumentation hat sich der Volksglauben aber immer
widersetzt und hat die Vorstellung vom eigenen Hundehimmel entwickelt, der
anscheinend als vor dem eigentlichen Himmel hegend gedacht wird und dem treuen
Hund als Lohn winkt.
In seiner Narrenbeschwörung
greift Thomas Murner (um 1475-1537) diese Vorstellung auf, wenn
er zu dem Hund Weckerlein sagt:
«Darum, liebs Weckerlin, lide dich,
Du kommst in der Hund Himmelrich;
Zu tot geschlagen und geschunden,
Den Lohn die Welt gibt allen Hunden» (234).
Und auch Luther pflichtete dem bei, als er von seinen
Schülern gefragt wurde, ob die Hunde auch in den Himmel kommen: «Ja freilich, denn
Gott wird einen neuen Himmel und ein neues Erdreich schaffen, auch neue
Pelverlein (<Belferlein>) und Hünd- lein mit goldener Haut».
Aus: Helmut Brackert, Cora van Kleffens, Von Hunden und Menschen. Geschichte einer
Lebensgemeinschaft, München 1989, S. 76 ff.
Neuer Absatz
Neuer Absatz
Giorgio Agamben: "Weltarmut"
"Das Benehmen des Tieres ist nie ein
Vernehmen von etwas als etwas."
Martin Heidegger
Im Wintersemester 1929/1930 hält Martin Heidegger an
der Universität Freiburg seine Vorlesung Die Grundbegriffe der Metaphysik.
Welt - Endlichkeit - Einsamkeit. Als er 1975, ein Jahr vor seinem Tod, den
Text der Vorlesung zur Publikation freigibt (die erst 1983 in den Bänden 29/30
der Gesamtausgabe erfolgt), fügt er ihm in limine eine Widmung
für Eugen Fink hinzu und erinnert damit daran, daß dieser "wiederholt den
Wunsch äußerte, diese Vorlesung möchte vor allen anderen veröffentlicht
werden." Von seiten des Autors ist dies gewiß eine diskrete Geste, um die
Wichtigkeit zu unterstreichen, die er jenen Lektionen beigemessen hatte und
1975 immer noch beimaß. Warum steht diese Vorlesung idealiter vor allen
anderen, das heißt all jenen Vorlesungen, die im Projekt der Gesamtausgabe
45 Bände umfassen?
Die Antwort ist nicht einfach, auch weil die Vorlesung
- wenigstens auf den ersten Blick - nicht ihrem Titel entspricht und in keiner
Weise als eine Einleitung zu den grundlegenden Konzepten jener so besonderen
Disziplin, der "Ersten Philosophie", auftritt. Vielmehr widmet sie sich zunächst
einer ausführlichen Analyse der "tiefen Langweile" als einer grundlegenden
emotionalen Stimmung, die etwa zweihundert Seiten umfaßt, und gleich darauf einer noch umfassenderen Untersuchung
zur Beziehung des Tieres zu seiner Umwelt und zu derjenigen des Menschen zu
seiner Welt.
Heidegger geht es darum, durch die Beziehung zwischen
der Weltarmut* des Tieres und dem weltbildenden* Menschen
dieselbe grundlegende Struktur des Daseins* - des Inder-Welt-Seins - in
bezug auf das Tier zu bestimmen, um auf diese Weise nach Ursprung und Sinn
jener Öffnung nachzudenken, die mit dem Menschen im Lebewesen entstanden ist.
Heidegger hat bekanntlich die traditionelle metaphysische Definition des
Menschen als animal rationale, als könnte das Wesen des Menschen als das
mit Sprache (oder Vernunft) begabte Lebewesen durch die einfache Hinzufügung
von etwas zum "bloßen Lebewesen" bestimmbar sein, hartnäckig abgelehnt. In den
Paragraphen 10 und 12 von Sein und Zeit versucht er zu zeigen, wie die
dem Dasein* eigene Struktur des In-der-Welt-Seins
immer schon in jeder (sei es philosophischen, sei es wissenschaftlichen)
Konzeption des Lebens vorausgesetzt ist, so daß das Leben in Wahrheit
immer "auf dem Weg einer privativen Interpretation" von dieser Struktur aus
definiert wird.
"Leben ist
eine eigene Seinsart, aber wesenhaft nur zugänglich im Dasein. Die Ontologie
des Lebens vollzieht sich auf dem Wege einer privativen Interpretation; sie
bestimmt das, was sein muß, daß so etwas wie Nur-noch-leben sein kann. Leben
ist weder pures Vorhandensein, noch aber auch Dasein. Das Dasein wiederum ist
ontologisch nie so zu bestimmen, daß man es ansetzt als Leben - (ontologisch
unbestimmt) und als überdies noch etwas anderes." (Heidegger 1967, S. 50)
Gerade dieses metaphysische Spiel von Voraussetzung
und Aufschub, von Entzug und Supplement zwischen dem Tier und dem Menschen wird
in den Vorlesungen von 1929/1930 zur Diskussion gestellt. Die
Auseinandersetzung mit der Biologie, die in Sein und Zeit in wenigen
Zeilen beiseite geschoben wurde, wird jetzt mit dem Versuch wieder
aufgenommen, die Beziehung zwischen dem bloßen Lebewesen und dem Dasein*
radikaler zu denken. Aber gerade hier erweist sich der Spieleinsatz als derart
hoch, daß die Notwendigkeit verständlich wird, diese Vorlesungen vor allen
anderen zu veröffentlichen. Im Abgrund - und gleichzeitig in der einzigartigen
Nähe -, den die nüchterne Prosa der Vorlesung zwischen Tier und Mensch
offenlegt, verliert nicht nur die animalitas, indem sie als dasjenige
vorgeführt wird, "was am schwersten zu denken ist", jegliche
Selbstverständlichkeit, sondern auch die humanitas erscheint als etwas
Ungreifbares und Abwesendes, schwebend zwischen einem "Nicht-bleiben-Können"
und einem "Den-Platz-nicht-aufgeben-Können".
Der rote Faden, der sich durch Heideggers Ausführungen
zieht, ist durch eine dreifache These gegliedert:
"Der Stein ist weltlos, das Tier ist weltarm, der Mensch ist weltbildend." Da
der Stein (das Leblose), dem jeglicher Zugang zu dem, was ihn umgibt, verwehrt
ist, schnell abgefertigt wird, kann Heidegger seine Untersuchung mit der
mittleren These beginnen, indem er unverzüglich das Problem angeht, was man
sich unter "Weltarmut" vorzustellen hat. Die philosophische Analyse ist hier
gänzlich auf die zeitgenössischen Untersuchungen der Biologie und Zoologie
gerichtet, im einzelnen auf diejenigen von Hans Driesch, Karl von Baer,
Johannes Müller und besonders auf diejenigen seines Schülers Jakob von Uexküll.
Nicht nur wird festgehalten, daß die Untersuchungen Uexkülls "zum
Fruchtbarsten gehören, was die Philosophie heute sich aus der herrschenden
Biologie zueignen kann". Darüber hinaus ist der Einfluß auf die Konzepte und
die Begriffe der Vorlesungen einschneidender, als es Heidegger selbst erkennt,
wenn er schreibt, daß sein Wortschatz zur Definition von Weltarmut des Tieres
nichts anderes ausdrückt, als was Uexküll mit den Begriffen Umwelt und Innenwelt
meint (Heidegger 1983, S. 383). Heidegger setzt das Enthemmende für
Uexkülls Definition von Bedeutungsträger und Merkmalträger und Enthemmungsring
für Umwelt. Uexkülls Wirkorgan entspricht Heideggers Fähigkeit
zu, die im Gegensatz zu einem einfachen mechanischen Mittel ein Organ
definiert. Das Tier ist in seinem eigenen Enthemmungsring eingeschlossen, der
wie bei Uexküll aus den wenigen Elementen besteht, die seine Wahrnehmungswelt
ausmachen. Deswegen kann das Tier wie bei Uexküll, "wenn es zu Anderem in
Beziehung kommt, nur auf solches treffen, was das Fähigsein ,angeht',
anläßt. Alles andere vermag im vorhinein nicht in den Umring des Tieres
einzudringen." (Heidegger 1983, S.369)
Aber gerade in der Interpretation der Beziehung
zwischen Tier und Enthemmungsring und in der Untersuchung des Wesens dieser
Beziehung weicht Heidegger von seinem
Vorbild ab, um eine Strategie zu erarbeiten, in welcher das Verständnis
von Weltarmut und menschlicher Welt
parallel voranschreitet.
Das Wesen des Tieres, das seine Beziehung zum Enthemmenden
definiert, ist seine Benommenheit. Heidegger spielt hier mit einer
wiederholten etymologischen Figur auf die Verwandtschaft der Begriffe benommen, eingenommen und Benehmen
an, die alle auf das Verb nehmen verweisen (aus der indoeuropäischen
Wurzel *nem mit den Bedeutungen von ,teilen', ,zuteilen'). Insofern das Tier
grundlegend benommen und vollständig eingenommen vom eigenen Enthemmenden ist,
kann es nicht wirklich handeln oder sich ihm gegenüber verhalten.
Es kann sich nur benehmen.
"Das
Benehmen als Seinsart überhaupt ist nur möglich aufgrund der Eingenommenheit
des Tieres in sich. Wir kennzeichnen das spezifische tierische
Bei-sich-sein, das nichts von einer Selbstheit des sich verhaltenden
Menschen als Person hat, diese Eingenommenheit des Tieres in sich, darin alles
und jedes Benehmen möglich ist, als Benommenheit. Nur sofern das Tier
seinem Wesen nach benommen ist, kann es sich benehmen. [...] Die Benommenheit
ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, daß das Tier seinem Wesen nach in
einer Umgehung sich benimmt, aber nie in einer Welt." (Ebd., S. 347f.)
Als anschauliches Beispiel
der Benommenheit, die sich nie auf eine Welt hin öffnen kann, erwähnt
Heidegger ein bereits von Uexküll beschriebenes Experiment, in welchem eine
Biene im Laboratorium vor eine Schale voller Honig gehalten wird. Wenn man der
Biene, nachdem sie zu saugen begonnen hat, den Hinterleib abtrennt, fährt sie
ruhig fort zu saugen, während der Honig aus dem offenen Hinterleib herausfließt.
"Das zeigt
aber schlagend, daß die Biene in keiner Weise das Zuvielvorhandensein von
Honig feststellt. Sie stellt weder dieses fest noch auch nur - was noch näher
läge - das Fehlen ihres Hinterleibes. Von all dem ist keine Rede, sondern sie
treibt ihr Treiben weiter, gerade weil sie nicht feststellt, daß immer noch
Honig vorhanden ist. Sie ist vielmehr einfach
von dem Futter hingenommen. Diese Hingenommenheit ist nur möglich,
wo triebhaftes Hin-zu
vorliegt. Diese Hingenommenheit in dieser Getriebenheit schließt aber zugleich die Möglichkeit einer Feststellung des
Vorhandenseins aus. Gerade die Hingenommenheit vom Futter verwehrt dem
Tier, sich dem Futter gegenüberzustellen." (Ebd., S. 352f.)
An dieser Stelle fragt Heidegger über das Wesen der
Öffnung der Benommenheit selbst weiter und beginnt so, die Beziehung zwischen
Mensch und Tier fast wie eine Hohlform zu skizzieren. Auf was hin ist die Biene
geöffnet, was kennt das Tier, wenn es zum Enthemmenden in Beziehung tritt?
Heidegger hält fest, gleichsam mit den Komposita des
Verbs nehmen weiterspielend, daß man hier kein Vernehmen vorfindet,
sondern nur ein instinktives Benehmen, insofern dem Tier "die
Möglichkeit des Vernehmens von etwas als etwas genommen ist, und zwar
nicht jetzt und hier, sondern genommen im Sinne des ȟberhaupt nicht gegebem"
(ebd., S. 360). Das Tier ist insofern benommen, als ihm diese Möglichkeit
radikal genommen worden ist.
"Benommenheit des Tieres
besagt also einmal: wesenhafte Genommenheit jeglichen Vernehmens von etwas
als etwas, sodann: bei solcher Genommenheit gerade eine Hingenommenheit
durch ... Benommenheit des Tieres kennzeichnet also einmal die Seinsart,
gemäß der dem Tier in seinem Sichbeziehen auf anderes die Möglichkeit genommen
ist oder, wie wir sprachlich auch sagen, benommen ist, sich dazu, zu diesem
anderen, als dem und dem überhaupt, als einem Vorhandenen, als
einem Seienden, zu verhalten und sich darauf zu beziehen. Und gerade weil dem
Tier diese Möglichkeit, das, worauf es sich das Sich-nicht-Einlassen-auf... ist
ein Offensein vorausgesetzt. In all dem liegt: Bei der Weltlosigkeit des Steins
fehlt sogar auch die Bedingung der Möglichkeit der Weltarmut. Diese innere
Möglichkeit der Weltarmut - ein konstitutives Moment dieser Möglichkeit - ist
das triebhafte Offensein der benehmenden Hingenommenheit. Dieses Offensein
besitzt das Tier in seinem Wesen. Das Offensein in der Benommenheit ist wesenhafte
Habe des Tieres. Aufgrund dieser Habe kann es entbehren, arm sein, in
seinem Sein durch Armut bestimmt sein. Dieses Haben ist freilich kein Haben
von Welt, sondern das Hingenommensein an den Enthemmungsring - ein Haben
des Enthemmenden. Aber weil dieses Haben das Offensein für das Enthemmende
ist, diesem Offensein-für jedoch gerade die Möglichkeit des Offenbarhabens des
Enthemmenden als Seiendem genommen ist, deshalb ist diese Habe des Offenseins
ein Nichthaben, und zwar ein Nichthaben von Welt, wenn anders zur Welt Offenbarkeit
von Seiendem als solchem gehört." (Ebd., S. 391 f.)
Aus: Giorgio Agamben,
"Weltarmut", in: G.A., Das Offene. Der
Mensch und das Tier, Frankfurt 2003, S. 57-64
Neuer Absatz
Neuer Absatz
Tiere haben Verstand - Gryllos
[Odysseus im Gespräch mit der Zauberin Kirke (vgl. Odyssee
10), die seine Gefährten in Schweine verwandelt hat.]
1. Odysseus:
Was wir bisher besprochen haben, meine liebe Kirke, das habe ich, glaub ich,
verstanden und werde es wohl auch behalten. Nun würde ich gern noch von dir
erfahren, ob da auch Griechen unter den Leuten sind, die du aus Menschen in
Wölfe und Löwen verwandelt hast.
kirke: O
ja, sehr viele, mein liebster Odysseus. Aber warum fragst du das?
odysseus:
Weil es mir doch wahrlich unter den Griechen Ruhm und Ehren bringen würde, wenn
ich durch deine Gunst diese meine Kameraden wieder zu Menschen machen könnte. Und wenn ich es nicht zuließe, dass sie
ihrer Natur zuwider im Körper von Tieren stecken und bis zum Alter in einer so
elenden und schimpflichen Existenz dahinvegetieren.
kirke: Da
hört euch den Mann an! In seiner Torheit meint er, seine Ruhmesbegierde müsse nicht
nur ihm und seinen Gefährten, sondern auch Leuten, die ihn gar nichts angehen,
zum Unglück gereichen!
odysseus:
Einen neuen Zaubertrank mischst du mir, Kirke, diesmal mit Worten, mit denen
du mich verwirrst und vernebelst: Du würdest mich ja sicher schon dadurch zum
Tier machen, wenn ich es mir von dir einreden ließe, es wäre ein Unglück, wenn
einer aus einem Tier ein Mensch würde!
kirke:
Hast du nicht selbst schon ganz andere Verwandlungskünste durchgespielt, da du
das unsterbliche, nie alternde Leben mit mir verschmäht hast112 und
zu einer sterblichen Frau hinstrebst - die jetzt, das kann ich dir sagen, schon
eine alte Frau ist - durch tausend Nöte und Gefahren, nur um dadurch noch mehr
bewundert und gepriesen zu werden, als du es jetzt schon bist. Jagst du damit
nicht einem leeren Schattenbild nach statt eines wahren Glücks?
112
In der Odyssee ist es Kalypso. Odysseus lehnt das Leben mit ihr ab und
will nach Ithaka zu Penelope zurückkehren (Odyssee 5,203 ff.)
Odysseus: Na
gut, lass es sein, wie du willst, Kirke - was sollen wir uns immer wieder um
dieselben Dinge streiten? Aber lass diese Männer frei - tu es mir zuliebe.
KIRKE: Das geht nicht so einfach, bei Hekate." Das
sind ja keine Leute, über die man so einfach verfügen kann. Aber frag du
sie zuerst, ob sie überhaupt wollen.
Sagen sie nein, dann musst du mit ihnen diskutieren, du großer Redeheros, und
sie überreden. Falls du sie nicht überzeugst und sie besiegen vielmehr dich in
der Diskussion, dann musst du dir eingestehen, dass du, was dich und deine
Freunde angeht, die schlechteren Argumente gehabt hast.
Odysseus: Du
machst dich über mich lustig, selige Göttin. Wie könnten sie denn mir Rede und
Antwort stehen, solange sie Esel oder Schweine oder Löwen sind?
KIRKE: Keine Angst, du Ruhmsüchtigster von allen. Ich
will sie dir so vorführen, dass sie dich verstehen und mit dir reden können.
Noch besser: Einer wird doch genug sein, der dir im Namen aller Rede steht. Da, sprich
doch mit diesem [einem Schwein]!
Odysseus:
Aber wie soll ich ihn denn anreden, Kirke - wer war er denn unter den Menschen?
kirke:
Das ist doch egal. Nenne ihn Gryllos [Grunzer], wenn du willst. Ich lasse euch
jetzt allein, damit es nicht so aussieht, als spräche er mir zuliebe gegen
seine Überzeugung.
2. GRYLLOS:
Hallo, Odysseus!
Odysseus:
Hallo, Gryllos, wie geht's?
Gryllos:
Was möchtest du denn fragen?
ODYSSEUS: Ich weiß, dass ihr Menschen gewesen seid,
und ich bemitleide euch alle, die ihr in diesem Zustand seid, aber natürlich
tut ihr mir vor allem leid, die ihr Griechen wart und nun in dieses Elend
geraten seid. So habe ich nun Kirke darum gebeten, jeden von euch, der will, zu befreien
und wieder in seine frühere Gestalt zurückzuverwandeln und mit uns ziehen zu
lassen.
GRYLLOS: Stop, Odysseus - kein Wort mehr davon. Du imponierst
uns allen hier gar nicht. Du galtest als ein wunder wie schlauer Mann, der die
ganze Menschheit an Klugheit übertrifft." Aber das ganz zu Unrecht. Fürchtest
du dich doch nun vor der Versetzung aus einem schlechten in einen besseren
Zustand - und das kapierst du nicht. Gerade wie Kinder sich vor den Arzneien
der Ärzte scheuen und vor ihren Schulstunden Reißaus nehmen - was beides sie
doch aus kranken und törichten Geschöpfen zu gesünderen und vernünftigeren machen
würde -, gerade so sträubst du dich davor, ein anderer zu sein. Nun aber bist
du nur mit Zittern und Zagen mit Kirke zusammen und hast Angst, sie würde dich
unversehens in ein Schwein oder einen Wolf verwandeln. Und du
willst uns, die wir hier in reichstem Überfluss leben, überreden, das alles aufzugeben
und mitsamt den guten Gaben auch ihre Spenderin zu verlassen und mit dir auf
und davon zu gehen - wieder zu Menschen geworden, diesen mühseligsten aller Geschöpfe!
Odysseus: Du
scheinst mir, mein lieber Gryllos, mit diesem Zaubertrank nicht nur die
Gestalt, sondern auch den Verstand verloren zu haben und dafür mit
widersinnigen und total abwegigen Vorstellungen angesteckt zu sein. Oder hast
du von jeher Freude an dieser säuischen Lebensweise gehabt, und das hält dich
an diesen Körper gebannt?
gryllos:
Nichts davon, o König der Kephallenier." Willst du aber lieber diskutieren als
diffamieren, dann werde ich dich rasch überzeugen, dass wir
ganz mit Recht diesen Zustand dem früheren vorziehen - wir kennen ja
schließlich beide Lebensformen.
Odysseus:
Also los, ich bin begierig, dich zu hören.
3. Gryllos:
Und ich, mit dir zu reden. Wir sollten mit den Tugenden anfangen, auf die ihr, wie wir sehen, euch so
viel einbildet - als ob ihr die Tiere an Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit
und allen anderen Tugenden weit übertreffen würdet. Jetzt gib mir Antwort, du weisester aller Männer! Ich
hörte dich einmal, wie du Kirke vom Land der Kyklopen erzählt hast. Obwohl man
dort gar nicht pflügt und sät, ist es von Natur aus so fruchtbar und ergiebig,
dass es von selbst alle Arten von Früchten hervorbringt. Welches Land schätzt
du nun höher ein, dieses oder das steinige Ithaka, das nur Ziegen nährt und den
Bauern für ihre viele Arbeit und große Anstrengung nur mageren und kümmerlichen
Ertrag bringt, kaum der Mühe wert? Aber werde mir nicht böse, wenn du dich aus
patriotischen Gefühlen verpflichtet fühlst, eine Antwort zu geben, die gegen
die augenscheinliche Wirklichkeit spricht.
ODYSSEUS: Ich habe keinen Grund zu lügen. Freilich
schätze und liebe ich vor allem mein Vaterland und meinen Heimatboden, das
andere Land aber muss ich loben und bewundern.
gryllos: Da
haben wir also folgendes festgestellt: Der weiseste aller Menschen ist der
Ansicht, man könne das eine rühmen und billigen, ein anderes aber wählen und
lieben. Du hast damit aber auch, so will ich einmal annehmen, eine Antwort über
die Seele gegeben. Das gleiche gilt für sie wie für das Land. Die bessere ist
diejenige, welche die Tugend ohne Bearbeitung als eine spontan wachsende Frucht
hervorbringt.
ODYSSEUS: Ja, auch das will ich dir zugeben.
gryllos: Damit gibst
du auch zu, dass die Seele von Tieren für die Ausübung der Tugend von Natur aus
besser geartet und vollkommener ist. Denn ohne Geheiß und Belehrung - wie das
unbesäte und ungepflügte Land - bringt die Seele des Tieres von Natur aus die
Tugend hervor und lässt sie wachsen, wie sie für jede Kreatur passend ist.
Odysseus:
Und was soll das für eine Tugend sein,
Gryllos, die Tiere haben?
4. Gryllos:
Welche Tugend, müsste man fragen, findet sich bei ihnen nicht noch viel
mehr als beim weisesten aller Menschen? Betrachte
nur bitte zuerst die Tapferkeit, auf
die du so stolz bist, dass du dich nicht schämst, ein tollkühner Draufgänger
und der Städtezerstörer genannt zu werden. Dabei hast du Spitzbube nur durch
Lug und Trug Menschen vernichtet," die nur eine geradlinige und
ehrliche Kriegführung kannten und nichts wussten von betrügerischen
Machenschaften. Deine skrupellose Tücke hast du nun glorifiziert mit dem Namen
der Tugend - die doch mit solch ränkevoller Schlauheit ganz und gar nichts
gemein hat. Die Kämpfe der Tiere untereinander wie auch gegen euch Menschen sind frei
von aller List und allen Tricks. Offen
und frei vertrauen sie bloß auf ihre angeborene Kraft, wenn sie sich zur Wehr
setzen. Kein Gesetz ruft sie dazu auf, sie fürchten sich nicht vor der Strafe
für Deserteure.
Ihrer Natur nach scheuen sie sich vor dem Unterliegen,
daher halten sie aus bis zum Äußersten und bewahren ihren Kampfgeist
unerschütterlich. Denn wenn sie auch ihren Körperkräften
nach überwunden sind, geben sie sich nicht besiegt, sondern kämpfen bis zu
ihrem letzten Atemzug. Oft kommt es vor, dass sich bei sterbenden Tieren die
Kampfeswut in ein Glied des Körpers zurückzieht und sich dort konzentriert, dem
Mörder widersteht in wilder und grimmiger Bewegung, bis sie so wie ein Feuer
schließlich ganz schwindet und verlöscht.
Bei Tieren gibt es auch kein Bitten und Flehen um
Pardon oder ein Eingeständnis der Niederlage. Kein Löwe wird aus Feigheit Sklave
eines Löwen, kein Pferd Knecht eines anderen so wie ein Mensch, der sich
bereitwillig mit der Knechtschaft abfindet, deren Name ja mit dem der Feigheit
verbunden ist. Wurden
Tiere durch Fallen gefangen, dann weisen die schon erwachsenen jede Nahrung
zurück, halten den Durst aus, weil sie lieber tot als in Knechtschaft sein
wollen. Die Jungen aber, die noch klein oder nicht flügge sind und eben wegen
ihres Alters noch zart und leicht beeinflussbar sind, werden durch allerlei
betrügerische Lockmittel und Spielereien kirre gemacht und gewöhnt an
unnatürliche Genüsse und Lebensweisen, bis sie mit der Zeit so saft- und
kraftlos sind, dass sie sich die sogenannte Domestikation geduldig gefallen
lassen - dabei werden sie nur verweichlicht und ihres natürlichen Elans
beraubt. All dies zeigt klar genug, dass die Tiere von Natur aus mit
Kühnheit und Tapferkeit ausreichend begabt sind.
Beim Menschen ist diese Art von Herzhaftigkeit eher nicht von Natur aus
gegeben. Das kannst du, Odysseus, mein Bester, klar
aus folgendem erkennen: Bei den Tieren ist Kraft und Stärke gleichmäßig auf beide Geschlechter
verteilt. Das weibliche gibt dem männlichen nichts nach, weder in den Mühen um
den Lebensunterhalt noch bei der Verteidigung ihrer Jungen. Du hast doch sicher schon von der Sau von Krommyon
gehört, die, obwohl von weiblichem Geschlecht, dem Theseus ziemliche
Mühe gemacht hat. Und die berühmte Sphinx hätte nichts gehabt von ihrer
Ranküne, als sie da auf dem Berg Phikion bei Theben saß und Rätsel und
Verwirrsprüche ersann, wenn sie nicht mit ihrer Stärke und Kühnheit die
Thebaner in ihrer Gewalt gehabt hätte. Dort in der Gegend lebte auch der
Teumessische Fuchs, eine Füchsin, ein schreckliches Untier, und nahe dabei
soll auch die Pythonschlange gehaust haben, die sich mit Apollon einen Kampf
lieferte um den Orakelsitz von Delphi. Die Stute Aithe nahm euer König
[Agamemnon] von dem Herrscher von Sikyon an, der sich damit von der Teilnahme
am Feldzug gegen Troja freikaufte. Agamemnon tat klug daran: Er zog
einem feigen Mann ein tüchtiges, sieggewohntes Pferd vor. Du selbst hast sicher schon öfters gesehen, wie bei Panthern
und Löwen die weiblichen Tiere den männlichen an Mut und Stärke keineswegs
nachstehen. Aber deine Frau - während du fort bist im Krieg, sitzt sie zu Hause
hinterm Ofen und macht es nicht einmal so wie die Schwalben, dass sie die
abwehrt, die es auf sie und ihr Haus abgesehen haben. Und das obwohl sie doch
eine Spartanerin ist. Was soll ich da noch von Frauen in so verweichlichten
Ländern wie Karien oder Maeonien [in Kleinasien] erzählen?
Aus dem bisher Gesagten geht schon zur Genüge hervor,
dass den Männern die Tapferkeit [als allgemein menschliche Tugend] nicht
einfach von der Natur mitgegeben worden ist. Sonst müssten auch die Frauen ein
gleiches Maß an Tapferkeit besitzen. Demnach ist eure Tapferkeit eine
Folge des Zwangs der Gesetze, kein freiwilliger Entschluss. In sklavischer
Unterwerfung unter Konventionen, Kritik und die Vorurteile und Meinungen
anderer übt ihr eure sogenannte Mannhaftigkeit aus. Und wenn ihr Gefahren auf euch nehmt, dann nicht, weil
ihr sie mit Bravour bestehen wollt, sondern weil ihr euch noch mehr davor
fürchtet, was sonst passieren würde. Es ist gerade so, wie wenn einer eurer
Kameraden als erster aufs Schiff kommt und sich gleich an das leichte Ruder
stellt, nicht weil er sich nichts dabei denkt, sondern weil er das schwerere
fürchtet und vermeiden möchte. So ist derjenige, der Schläge aushält, um keine
Wunden zu bekommen und sich gegen den Feind wehrt, um Martern oder dem Tod zu
entgehen [bei Desertion], nicht beherzt und tapfer gegenüber der einen, sondern
feige gegenüber der anderen Möglichkeit. So ist es klar, dass eure
Mannhaftigkeit eine kalkulierte Feigheit ist, und all euer Mut eigentlich nur
Furcht, die euch das eine wählen lässt, um dem anderen zu entgehen. Und
überhaupt: Wenn ihr glaubt, dass ihr Menschen in der Tapferkeit den Vorrang besitzt
gegenüber den Tieren - warum nennen dann eure Dichter die tapfersten Krieger
wölfisch gesinnt, löwenmutig und einem Eber gleich an Stärke? Keiner bezeichnet
den Löwen als männermutig oder den Eber dem Mann gleich an Stärke. Aber so wie sie in dichterischer Übertreibung die
Schnellen windsfüßig nennen und die Schönen göttergleich, so nehmen sie hier,
denke ich, auch den Vergleichsmaßstab für tapfere Kämpfer aus einer höheren
Ebene. Der Grund dafür: Der Mut ist es, der die Tapferkeit stählt und härtet, und dieser kämpferische
Elan, den die Tiere im Kampf beweisen, ist rein und unvermischt, bei euch
Menschen aber durch Überlegung verdünnt -
da ist Wasser in den Wein gegossen, deswegen lässt dieser Mut seinen Mann
angesichts von Gefahren im Stich und verpasst den günstigen Zeitpunkt. Einige
unter euch behaupten sogar, man dürfe den Mut - gemeint ist die zornige
Erregung - im Kampf ganz und gar beiseitelassen und ohne ihn nur die nüchterne
Überlegung walten lassen. Da haben sie schon recht, was die Selbsterhaltung
betrifft, aber wenn es um Stärke und Gegenwehr geht, ist das eine äußerst
schmähliche Auffassung. Oder ist das nicht ein Widerspruch: Einerseits beklagt
ihr Menschen euch bei der Natur, dass sie eure Körper nicht mit Stacheln,
Hauern oder scharfen Klauen ausgestattet hat, andererseits aber beraubt ihr
selbst eure Seele ihrer angeborenen Waffe oder stumpft sie ab.
5. Odysseus:
Meine Güte, Gryllos, du scheinst mir ein rechter übergescheiter Philosoph
gewesen zu sein, wenn du auch jetzt noch aus deiner Schweinsnatur heraus deine
Ansichten mit jugendlichem Feuer zu verfechten weißt. Doch warum hast du nicht
auch die Selbstbeherrschung und Mäßigung als nächste Tugend mit abgehandelt?
GRYLLOS: Weil ich annahm, du würdest zunächst deine Einwände
gegen meine Rede Vorbringen wollen. Aber nun kannst du es gar nicht abwarten,
etwas über Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit zu hören - du bist ja der
Ehemann eines Musters an keuscher Selbstbeherrschung und glaubst, selbst eine
Probe davon abgelegt zu haben, als du Kirkes erotische Avancen zurückgewiesen
hast. Aber auch darin bist du keineswegs besser als die Tiere. Auch sie haben
keinerlei Neigung, sich mit höheren Wesen zu verbinden, sondern suchen die
Liebesfreuden nur bei ihresgleichen.
So ist deine Haltung durchaus nichts Bewundernswertes. Da gibt es ja die Geschichte
von dem Ziegenbock aus Mendes in
Ägypten, der mit vielen schönen Frauen eingeschlossen ist, aber keine Neigung
hat, sich mit ihnen zu paaren; sein leidenschaftliches Verlangen richtet sich
vielmehr auf Ziegen. Gerade so ist es auch bei dir: Du bist glücklich und
zufrieden mit deinen gewohnten Liebesfreuden und willst nicht als Sterblicher
mit einer Göttin schlafen. Was aber die Keuschheit der Penelope angeht - zahllose
krächzende Krähen würden darüber lachen und spotten. Jeder weibliche Rabenvögel
bleibt Witwe, wenn der Partner gestorben
ist, und zwar nicht nur für kurze Zeit, sondern neun Menschenalter lang. So
bleibt deine schöne Penelope an Keuschheit neunmal zurück hinter jeder
beliebigen Krähe.
6. Doch da es dir nicht entgangen ist, dass
ich ein Sophist bin, erlaube mir auch, dass ich meinem Vortrag eine bestimmte Einteilung
gebe, indem ich zunächst den Begriff Enthaltsamkeit [sophrosyne]
definiere und dann die einzelnen Begierden analysiere. Enthaltsamkeit ist eine
gewisse Einschränkung und Regelung der Begierden. Es geht darum, die
unnatürlichen und überflüssigen auszumerzen, die notwendigen und naturgemäßen
aber auf das rechte Maß und den rechten Zeitpunkt zu reduzieren. Du kannst
sehen, dass es unzählige verschiedene Einteilungen der Begierden gibt. Das
Verlangen nach Essen und Trinken ist zugleich natürlich und notwendig. Das
sexuelle Begehren ist zwar ursprünglich von der Natur gegeben, doch kann man
auch auskommen, ohne ihm nachzugeben; daher nennt man diese Begierden
natürliche, aber nicht notwendige. Dann gibt es noch eine weitere Kategorie: die
weder notwendigen noch natürlichen. Die haben sich wie eine Schlammflut von
außen her ergossen - durch leere Einbildungen und einen Mangel an wahrer
Kultur. Und sie haben bei euch Menschen eine solche Überzahl gewonnen, dass
sie die natürlichen Bedürfnisse fast gänzlich verdrängt haben - so, als ob in
einem Staat eine invasion von
fremden Eindringlingen die angestammten Bürger überwältigt habe. Die Seelen der
Tiere sind dafür jedoch gänzlich unzugänglich und haben sich von fremden
Einflüssen ferngehalten. Sie leben weiterhin nach ihrer Art, ohne irgendwelchen
extravaganten Moden nachzulaufen, wie Siedler, die sich sicherheitshalber weit
vom Meer niedergelassen haben. Was so die feine, luxuriöse Lebensart angeht, da
können sie freilich mit euch nicht mithalten, sie bewahren aber strikt ihre
Selbstbeherrschung und halten ihre Begierden unter Kontrolle; es sind nicht
viele und nur ihnen eigene, aber keine wesensfremden.
Auch ich ließ mich früher einmal beeindrucken - so wie
du heute noch - vom Gold: Es schien mir ein unvergleichlicher Besitz. Auch
Silber und Elfenbein reizten mich, und einer, der davon die größte Menge besaß,
der war für mich ein Glückskind, ein Liebling der Erdenwinkel kommen, noch
niederträchtiger als Dolon oder unglückseliger als Priamos. So war ich damals
beständig an meine Begierden gefesselt und konnte daher keine Freude, kein
Vergnügen finden an den anderen Gütern, obwohl ich von denen so viel besaß,
dass es für alles ausreichte. Ich war unzufrieden mit meinem Leben, als wäre ich
ein armer Mann und bei der Verteilung der höchsten Güter leer ausgegangen.
Daher erinnere ich mich noch daran, als ich dich damals in Kreta sah in einem
festlichen, reich verzierten Gewand - da habe ich nicht deine Klugheit
bewundert, nicht deine heldenhafte Tugend, sondern den überaus fein gewebten
Stoff deines Gewandes und den prächtigen, eleganten Purpurmantel - das gaffte
ich an. Der Mantel hatte eine goldene Spange, darauf war eine Jagdszene, glaube
ich, in feinster Arbeit eingraviert. Und ich folgte dir ganz
bezaubert, wie Frauen, wenn sie so etwas betrachten. Aber jetzt bin ich
geläutert und frei von solchen nichtigen Vorstellungen und gehe an Gold und
Silber so gleichgültig vorbei wie an irgendwelchen Steinen. Und auf deinen
Prachtgewändern und Teppichen würde ich bei Gott kein bisschen sanfter
ausruhen, wenn ich satt bin und mich niederlege, als in tiefem und weichem
Schlamm. Von solchen Luxusbedürfnissen hat keine einen Platz in unseren
Seelen. Unser Leben ist zum großen Teil bestimmt von den notwendigen Begierden
und Freuden, und denen, die nicht notwendig, aber natürlich sind, gehen wir nie
in ungeregelter und maßloser Weise nach.
7. Diese wollen wir
nun zuerst beschreiben. Unser Vergnügen an wohlriechenden Substanzen, die
durch ihre Düfte den Geruchssinn stimulieren, hat - außer dass dieses unser Vergnügen
einfach zu haben ist und nichts kostet - auch noch den Nutzen, dass wir die
Nahrung nach gut oder schlecht unterscheiden können. Denn die Zunge ist und
heißt der Anzeiger für Süßes, Saures und Bitteres, sobald die Säfte sich
auflösen und in Kontakt mit dem Geschmacksorgan kommen. Unser Geruchssinn
erkennt aber schon, bevor wir gekostet haben, die Qualität jedes
Nahrungsstoffes und ist ein weitaus genauerer Beurteiler als die Vorkoster an
der königlichen Tafel. Dieser Geruchssinn lässt das ein, was gesund ist, weist
aber alles Schädliche ab und lässt nicht zu, dass wir es berühren oder den
Gaumen dadurch verletzen. Er mahnt und warnt vor dem Schaden, bevor dieser
eintreten kann. Dazu kommt noch, dass wir für die Geruchsstoffe keinen Aufwand
zu betreiben haben. Ihr müsst ja Räucherwerk, Zimt, Narde, indische Blätter,
arabische Kräuter haben - und das alles mit Hilfe eines aufwendigen
Alchimistenlabors oder eher einer Hexenküche, was ihr eine Duft- und
Salbenapotheke, eine Parfümerie nennt, zusammenmischen und einkochen. Und so gebt ihr
eine riesige Menge Geld aus, um euch einen teuren Luxus zu erkaufen; nichts
für Männer, eher Weiberkram und auf jeden Fall ganz ohne praktischen Nutzen. Aber
ungeachtet all dessen hat dieser Luxus nicht nur die Frauen samt und sonders
angesteckt, sondern schließlich auch die meisten Männer, und das geht so
weit, dass sie nicht mehr mit ihren Frauen ins Bett gehen wollen, wenn diese
nicht nach einem ganzen Parfümerieladen duften. Dagegen locken die Schweine die
Eber, die Ziegen die Böcke und alle weiblichen Tiere ihre Partner nur durch
ihren eigenen Geruch an. Duftend von reinem Tau, dem Geruch der Wiesen
und des jungen Grüns, paaren sie sich in gegenseitiger Zuneigung. Die
weiblichen Partner tun nicht spröde und verstecken ihre Neigung nicht mit allerlei Hinhaltetaktiken, und
die Männer, die die Begierde treibt, erkaufen sich den Zeugungsakt nicht mit
Geld, Mühe und Dienstleistungen. Sie finden ihren Liebesgenuss zur bestimmten
Zeit, ohne Trug und ohne Bezahlung, dann wenn die Jahreszeit die Begierde der
Tiere wie auch das Keimen der Pflanzen weckt und diesen Trieb dann wieder
erlöschen lässt. Das Weibchen lässt das Männchen nicht mehr zu, wenn es
befruchtet ist, und das Männchen macht auch keinen weiteren Versuch. So wenig
Wert messen wir der sexuellen Lust bei - alles richtet sich nach der Natur. Aus
diesem Grund haben die Begierden der Tiere bis jetzt auch noch nicht zu
sexuellen Beziehungen von Mann zu Mann und Frau zu Frau geführt. Bei euch gibt
es ja jede Menge von derartigen Beziehungen in den höchsten Kreisen, von den
unteren Schichten gar nicht zu reden. Da zog doch Agamemnon durch ganz Böotien,
auf der Jagd nach seinem entflohenen Liebling Argynnos und beschuldigte dann
fälschlich das Meer und die Winde. Schließlich hatte er die glorreiche Idee, im
Kopaissee zu baden, um darin sein Liebesfeuer zu löschen und von der
Leidenschaft frei zu werden. Ähnlich war es auch bei Herakles: Er suchte nach
seinem Gefährten, einem bartlosen Burschen, ließ die tapferen Helden zurück
und desertierte vom Argonautenzug. Im Kuppelgewölbe des Tempels des Apollon
Ptoios hat einer von euch heimlich die Verse an die Wand geschrieben: "Achilleus
ist schön" - dabei hatte Achilleus doch schon einen Sohn. Die Inschrift ist,
wie ich erfahren habe, immer noch dort. Wenn ein Hahn einen Hahn besteigt,
weil keine Henne da ist, dann wird er lebendig verbrannt, weil ein Wahrsager
oder Zeichendeuter diesen Fall für ein bedeutsames, Unheil verkündendes
Vorzeichen erklärt. So geben die Menschen selber zu, dass die Tiere in der Selbstbeherrschung eher
den Vorzug haben und in ihren Begierden gewöhnlich nicht wider die Natur
handeln. Euer zügelloses Treiben kann die Natur, selbst wenn sie vom Gesetz
unterstützt wird, nicht in Schranken halten, und wie von einem reißenden Strom
fortgerissen, tut ihr mit eurer Geilheit der Natur Gewalt an und richtet
Verwirrung und eine Zerstörung ihrer Ordnung an. Da haben sich ja Männer mit
Ziegen, Schweinen und Pferden abgegeben, und Frauen gerieten in sexuelle
Ekstase bei männlichen Tieren. Aus solchen Paarungen sind bei euch der
Minotauros, der ziegenfüßige Pan, und, wie ich vermute, auch die Sphingen und
die Kentauren entstanden. Es hat vielleicht einmal aus Hunger ein Hund von
einem menschlichen Körper gefressen oder ein Vogel in einer Notlage von
Menschenfleisch gekostet, aber kein Tier hat jemals einen Menschen als Sexualobjekt
gebraucht. Menschen aber missbrauchen Tiere, unter Zwang und widernatürlich, zu
vielerlei Arten von sexuellem Verkehr.
8. So lasterhaft und zügellos verhalten sich
die Menschen, was die Begierden angeht, von denen ich gesprochen habe. Doch es
lässt sich nachweisen, dass sie, was die notwendigen Bedürfnisse angeht, den
Tieren an Mäßigkeit und Enthaltsamkeit noch weit mehr nachstehen. Das sind die
Bedürfnisse, die sich auf Essen und Trinken beziehen. Wir Tiere suchen den
Genuss nur in Verbindung mit dem Nutzen; ihr aber seid mehr auf Genuss aus als
auf das natürliche Maß an Nahrung und werdet dafür bestraft durch eine Menge
schwerer Krankheiten, die alle aus einer Quelle entspringen, der Überladung des
Körpers, und euch mit allerhand Arten von Aufgeblähtsein anfüllen, die schwer
zu kurieren sind. Es ist grundsätzlich so, dass jede Tiergattung eine spezifische Nahrung
hat, entweder Gras oder Wurzeln und Früchte. Die fleischfressenden Tiere suchen
keine andere Art von Futter und nehmen nicht den schwächeren ihre Nahrung weg,
der Löwe lässt den Hirsch, der Wolf das Schaf dort weiden, wo es von Natur aus
seinen Platz hat. Der Mensch aber in seiner unersättlichen Genusssucht will
alles versuchen und kosten, als ob er noch nicht herausgefunden hätte, was ihm
zuträglich und angemessen ist. So ist er von sämtlichen Kreaturen der einzige
Allesfresser. Er verzehrt Fleisch, aber nicht aus Mangel oder Not - das bleibt
als erstes festzuhalten -, denn er hat zu jeder Zeit im Jahr einen so reichen
Vorrat an Pflanzen, Samen und Früchten, den er nacheinander pflückt und
schneidet, so dass ihm bei dieser überreichen Ernte geradezu die Arme lahm
werden. Doch seine Gier nach Genüssen führt ihn immer wieder zur Übersättigung
und zum Überdruss an den normalen Lebensmitteln, und so sucht er unnatürliche
Speisen, verunreinigt durch das Geschlachtete von Tieren und zeigt sich damit
weitaus grausamer als die wildesten Raubtiere.
Denn Blut, Getötetes und Fleisch sind für Raubvögel, Wölfe und Schlangen die
übliche Nahrung - für den Menschen ist es nur Zukost, ein Appetithappen. Außerdem
isst er das Fleisch von allen Tierarten; er macht es nicht wie die Raubtiere,
die zu ihrer Ernährung nur einigen wenigen Gattungen nachstellen, die meisten
aber in Ruhe lassen. Nein - nichts, was da kreucht und
fleucht, schwimmt oder auf dem Land lebt, kann eurer sogenannten feinen Küche
und eurer gastfreien Tafel entrinnen.
9. Nun gut. Ihr gebraucht die Tiere als
Appetithappen, um eure normale Kost damit anzureichern. Aber warum musstet ihr
deshalb gleich eine neue Wissenschaft erfinden, die Kochkunst? Die Intelligenz der Tiere aber will nichts zu tun haben mit nutz- und
zwecklosen Künsten. Die naturnotwendigen besitzen sie, ohne sie von anderen
übernommen oder gegen Lohn erlernt zu haben und ohne dass sie es nötig haben,
mit kleinlichem Fleiß eine Reihe von Lehrsätzen zusammenzustoppeln und für
jeden Bereich einen eigenen Spezialisten auszubilden. Die Tiere haben das erforderliche Wissen von Haus aus
und können es sogleich anwenden. Wir haben gehört, dass
in Ägypten jedermann ein Arzt ist. Von den Tieren aber ist jedes nicht nur ein
Experte in der Heilkunst, sondern auch für den Lebensunterhalt, zur Übung
seiner Kräfte, zur Jagd, zum Schutz vor Gefahren und sogar für die Musik,
soweit jedes Tier von Natur aus dazu ein Talent besitzt. Von wem hätten wir
Schweine es denn gelernt, wenn wir krank sind, an die Flüsse zu gehen, um Krebse
zu fangen? Wer hat die Schildkröten gelehrt, Oregano [Wilder Majoran] zu
essen, wenn sie von einer Schlange gefressen haben? Wer lehrte die wilden
Ziegen auf
Kreta, wenn sie von Pfeilen getroffen sind, Diktam aufzuspüren: Wenn sie davon
gefressen haben, treiben sie sich die Pfeilspitzen aus dem Körper. Wenn du sagst,
was die Wahrheit ist, die Natur sei ihre Lehrerin, dann führst du die
Intelligenz der Tiere auf das höchste Prinzip und die Quelle aller Weisheit
zurück. Glaubt ihr aber, diese Gabe der Tiere weder Vernunft noch
Einsicht nennen zu können, dann ist es Zeit, dass ihr euch nach einem schöneren
und ehrenvolleren Namen umseht, wie ja ohne Zweifel diese Kraft Besseres und
Bewundernswerteres hervorbringt [als die menschliche Intelligenz]. Denn die verstandesmäßige
Natur der Tiere ist nicht ungelehrig und unerziehbar; sie lernt vielmehr aus
sich selbst und genügt sich selbst, nicht aus Unvermögen, sondern gerade wegen
der Kraft und Vollkommenheit ihrer natürlichen Anlage, die verzichten kann auf
angelerntes Wissen. Was aber die Menschen zu ihrem Amüsement oder zu
Spiel und Sport den Tieren durch Lernen und Üben beizubringen suchen, das begreift
ihre Vernunft dank ihrer großen Fassungskraft, und die Tiere lernen ihre
Aufgaben, auch wenn sie von ihrem Körper her von Natur aus dafür gar nicht
geeignet sind. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass junge Hunde die
Fährte aufnehmen, junge Pferde lernen, sich in einer bestimmten Gangart zu
bewegen [als Passgänger], dass Raben sprechen und Hunde durch sich drehende
Reifen springen. Pferde und Stiere legen sich im Zirkus nieder, tanzen oder
nehmen bestimmte Stellungen ein oder machen Bewegungen, die selbst für Menschen
nicht leicht so exakt darzustellen wären. Und sie lernen das alles und behalten es,
was ein Beweis für ihre Gelehrigkeit ist, die für sie ja nicht den geringsten
Nutzen hat. Wenn du nicht glaubst, dass wir Künste [und zwar nützliche]
lernen, so höre nur, dass wir sie sogar lehren. Rebhühner lehren ihre Jungen
bei Gefahr sich zu verbergen, indem sie sich auf den Rücken legen und mit den
Füßen Erdschollen über sich halten. Und du siehst, wie auf den Dächern die erwachsenen Störche ihren Jungen bei ihren
Flugversuchen Hilfestellung leisten und sie anleiten. Die Nachtigallen
unterrichten ihre Jungen im Singen, und wenn diese jung gefangen und vom
Menschen aufgezogen werden, singen sie schlechter, gerade als ob sie zu früh
von ihren Lehrmeistern weggenommen worden wären.
Seit ich in
diesen Körper versetzt worden bin, kann ich mich nur wundern über diese
Argumente, durch die ich mich von den schlauen Philosophen bereden ließ zu
glauben, alle Lebewesen seien ohne Sinn und Verstand - außer dem Menschen.
10. Odysseus: Aber jetzt hast du deine Meinung total geändert,
mein lieber Gryllos, und hältst sogar Schafe und Esel für vernunftbegabt?
gryllos: Gerade von
diesen her, mein bester Odysseus, lässt sich ja der sicherste Beweis führen,
dass Tiere von Natur aus nicht ohne Logik und Verstand sind. So wie ein Baum
nicht mehr und nicht weniger Empfindung hat als ein anderer: sie haben nämlich
alle kein Bewusstsein, so könnte doch sicher auch unter den Tieren nicht das
eine stumpfsinniger oder weniger lernfähig erscheinen als ein anderes, wenn
man nicht voraussetzte, dass sie alle eine bestimmte Portion von Vernunft und
Einsicht besäßen, nur eben einige mehr, andere weniger. Bedenke nur, dass die Beschränktheit und Trägheit der
einen erst durch die Schlauheit und die rasche Auffassungsgabe der anderen
demonstriert wird, wenn du zum Beispiel Esel und Schaf mit dem Fuchs und dem
Wolf vergleichst. Das ist nicht viel anders, als wenn du den Riesen Polyphem
mit dir selbst vergleichst oder den sprichwörtlichen Dummkopf Koroibos mit
deinem oberschlauen Großvater Autolykos. Ich glaube jedenfalls, es ist bei
Tieren wie bei Menschen ziemlich gleich: Es unterscheidet sich der eine vom
andern, was Verstand, Urteils- und Erinnerungsvermögen angeht.
Odysseus:
Aber nun sieh doch, Gryllos: Ist es nicht ein bedenkliches und gewagtes Unternehmen, Lebewesen
Vernunft zuzuerkennen, die keinen Begriff von Gott haben!
GRYLLOS: Ei, mein lieber Odysseus - dann dürfen wir
auch nicht behaupten, dass ein solcher Mann wie du, das Muster aller Klugheit,
von einem Sisyphos abstammen könnte, der ja ganz ohne Götter auskam!
Text in:
Plutarch. Darf man Tiere essen?
Gedanken aus der Antike, aus d. Griech. v. Marion Geibel, Stuttgart 2015, S.
105-124
Neuer Absatz
|




